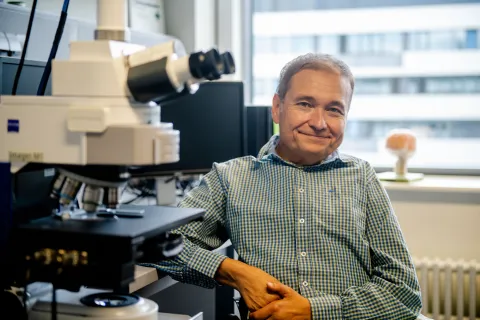Interview
Tee trinken und abwarten
Gunda Werner ist die erste Frau, die an der Katholisch-Theologischen Fakultät der RUB habilitiert wurde. Für ihre Forschungsarbeit fuhr sie 16.000 Kilometer auf dem Fahrrad durch ethnische Konfliktregionen.
Seit 50 Jahren gibt es die Katholisch-Theologische Fakultät an der RUB, aber erst jetzt wurde dort mit Ihnen die erste Frau habilitiert. Was glauben Sie, warum mussten wir so lange darauf warten?
Es gab über Jahre sehr viel weniger Frauen als Männer in der katholischen Theologie, was auch damit zusammenhängt, dass Frauen erst sehr spät zu diesem Studium zugelassen worden sind. Und immer noch sind Lehrstühle nur für Priester ausgeschrieben. Wirklich bedenklich finde ich, dass der Frauenanteil im Studium inzwischen zwar bei ungefähr 50 Prozent liegt, aber schon zur Promotion hin kippt das Verhältnis. 2014 gab es allerdings erstmals beinahe so viele Frauen, die sich habilitiert haben, wie Männer!
Haben Ihre Chefs Sie dabei unterstützt, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen?
Ja. Mein Doktorvater aus Münster wollte unbedingt, dass ich meine Promotion fertigstelle. Damals hatte ich eine Pause eingelegt. Er hat mich angerufen und mich überzeugt weiterzumachen. Und auch bei der Habilitation in Bochum wurde ich von meinem Chef sehr unterstützt. Als wir herausfanden, dass ich die erste Frau sein werde, die hier in katholischer Theologie habilitiert, fanden wir beide deutlich, dass es nun auch an der Zeit dafür ist.
Hatten Sie immer das Ziel, in der Wissenschaft zu arbeiten?
Nein, ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Da war ich 40 und hatte viele Jahre meines Lebens – auch parallel zur Promotion – Vollzeit außerhalb der Uni gearbeitet. In der Altenpflege, in der Seelsorge und beim Weltjugendtag. Nicht selten habe ich morgens um 5 Uhr für die Promotion am Schreibtisch gesessen und war ab 8 Uhr im Dienst.
Es war manchmal nicht einfach, diese beiden Parallelwelten überein zu bekommen. Wenn in einem Seminar über total theoretische Sachen diskutiert wurde, war ich oft in Gedanken im realen Leben und habe zum Beispiel überlegt, ob ich die Medikamente an die Patienten richtig verteilt habe.
Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich erkannt habe, dass ich beide Bereiche, den wissenschaftlichen und meinen beruflichen, miteinander verbinden kann; dass sich beide Enden ineinanderfügen und voneinander profitieren. Das war ein ganz schöner Moment für mich.
Sie hatten bei Ihrer Arbeit viel direkten Kontakt zu Menschen. Vermissen Sie das in Ihrer jetzigen Position, in der Sie hauptsächlich Schreibtischtäterin sind?
Ja, sehr. Ich möchte auch unbedingt meine ehrenamtliche Arbeit für die telefonische Aidsberatung wieder aufnehmen, die ruhen musste. Diese Erdung im normalen Leben ist mir nach wie vor sehr wichtig. Ich bin auch froh, dass ich während der Recherche für meine Habilitationsschrift so viel mit Menschen außerhalb der Universität in Kontakt kommen konnte.

Ihre Habilitationsschrift trägt den Titel „Die Freiheit der Vergebung“. Dafür sind Sie zwischen August 2010 und Oktober 2011 16.000 Kilometer auf dem Fahrrad entlang der Seidenstraße durch ehemalige Kriegsgebiete und ethnische Konfliktregionen gefahren. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich habe schon früh angefangen zu arbeiten, und mir war klar, dass ich gerne irgendwann ein Jahr Auszeit nehmen wollte. Außerdem bin ich leidenschaftliche Fahrradfahrerin und habe schon oft Urlaub auf zwei Rädern gemacht. Als sich abzeichnete, dass es mit dem Sabbatical klappen könnte, haben mein damaliger Mann und ich uns zusammen das Ziel gesetzt, auf dem Fahrrad so weit nach Osten zu fahren, wie wir es schaffen.
Da diese Route durch viele konfliktgeprägte Regionen führt, habe ich versucht, auf dieser Reise Antworten auf meine Forschungsfrage zu bekommen, wie Vergebung eigentlich funktionieren kann.
Ist Ihnen das gelungen?
Losgefahren bin ich mit der Frage nach dem Dialog, verstanden habe ich, dass Vergebung dafür wesentlich ist. Auf meiner Reise habe ich beobachtet, wie verfeindete Menschen miteinander umgehen. Schafft man es, dass sich zum Beispiel ein serbischer Orthodoxer mit einem bosnischen Muslim an einen Tisch setzt? Kann man erwarten, dass sie in Dialog treten? Ist Vergebung möglich und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Vergebung setzt voraus, dass Menschen ihre Schuld nicht auf andere übertragen. Nicht auf die Politik, nicht auf die Geschichte. Für seine eigene Schuld muss jeder selbst geradestehen. Das hat schon Kant thematisiert, doch bislang wurde nie geschaut, ab welchem Punkt das auch in der Theologie Relevanz bekam. Das habe ich in meiner Habilitation gemacht.

War es einfach für Sie, mit den Menschen über diese Themen zu sprechen?
Ich habe das nicht so offensiv angesprochen, habe keine standardisierten Interviews geführt, habe das Verhalten der Menschen nicht bewertet oder so. Ich habe von der Kultur in Asien gelernt: Tee trinken, zuhören, wahrnehmen, sich beschenken lassen. Das eröffnet einem einen sehr guten Zugang zu den Menschen. Das ist eigentlich meine Empfehlung für jede Lebenslage: Einfach Tee trinken und gucken, was sich entwickelt.
Wie sah Ihre Route genau aus?
Wir sind zuerst durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Serbien, Bosnien, Montenegro, Albanien, Kosovo und Mazedonien gefahren, dann durch Griechenland, die Türkei in den Irak, weiter in den Iran und von dort in die ehemaligen Sowjetstaaten, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan.
In diesen Ländern war vieles absolut schockierend. Wir kamen aus dem modernen Iran und landeten in Ländern, in denen weite Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom und fließendem Wasser haben. Zuletzt sind wir in China durch Xinjiang gekommen. Dort wollten wir eigentlich bis Schanghai, also ganz in den Osten, aber das haben wir nicht geschafft, weil uns ein Visum verwehrt wurde. Also sind wir von Kaxgar mit dem Zug nach Schanghai und von dort in die Fähre nach Japan gestiegen. Dort waren wir drei Monate lang, direkt nach dem Unglück in Fukushima.

Welches waren die eindrücklichsten Erfahrungen, die Sie in den 14 Monaten gemacht haben?
Positiv in Erinnerung wird mir immer die große Hilfsbereitschaft bleiben, die uns Reisenden entgegengebracht wurde. Wir sind so oft von Fremden eingeladen worden, sei es zum Tee trinken oder gleich zum Übernachten. Ganz besonders Fahrradtouristen werden unterstützt, wo es geht.
In der Türkei kam einmal ein Lehrer, der selbst Fahrradtouren fährt, extra aus dem Unterricht zu uns, nachdem er unsere vollgepackten Räder gesehen hatte. Er hat uns direkt eine Übernachtungsmöglichkeit in der nächsten Stadt organisiert. Weniger schön sind meine Erinnerungen an zwei Wintereinbrüche, die uns überrascht haben und die uns an unsere körperlichen Grenzen gebracht haben.
Hatten Sie nach Ihrer Reise erst einmal genug vom Fahrradfahren?
Nein, das Fahrrad begleitet mich ständig. Natürlich taten mir bestimmte Körperteile während der langen Tour weh, aber man nimmt das irgendwann nicht mehr so wahr. Fahrradreisen unternehme ich auch weiterhin. Das ist eine tolle Art, die Menschen und die Landschaft intensiv kennenzulernen.