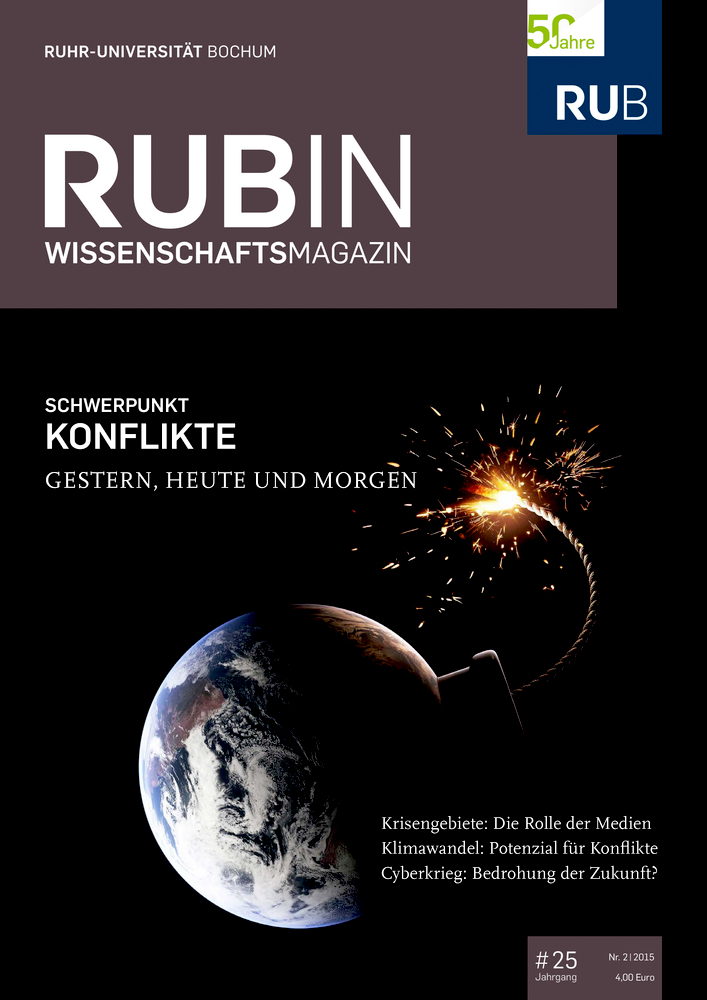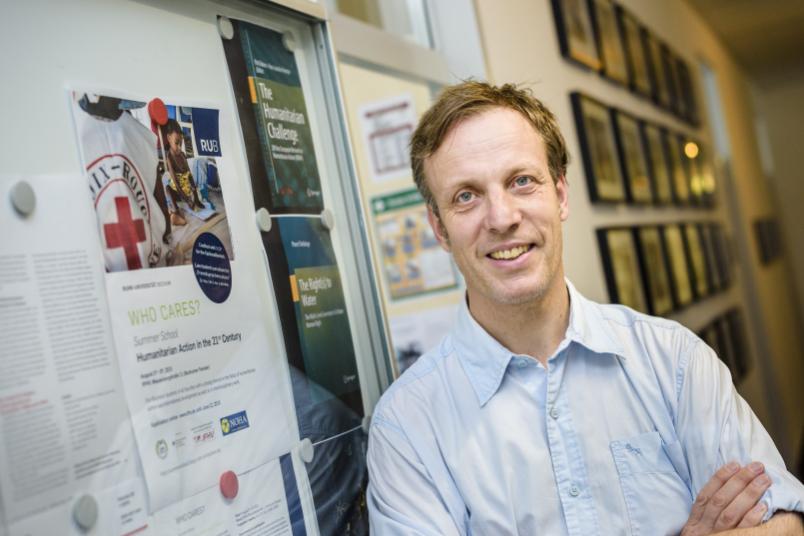
Interview
Über die Schwierigkeiten der humanitären Hilfe
Hilfsorganisationen sehen sich mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Welche das sind und wie die Organisationen damit umgehen, erzählt Dennis Dijkzeul, Experte für humanitäre Krisen in Rubin.
Prof. Dijkzeul, wir haben hohe Erwartungen an humanitäre Hilfsorganisationen. Sie sollen schnell und effektiv arbeiten, unparteilich sein und ihr Handeln an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen ausrichten. Wie ist das zu schaffen?
Schwierig. Zumal Konflikte heute vielfältiger sind als zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Hilfsorganisationen sind vielen verschiedenen Problemen ausgesetzt. Zum Beispiel sind heute an vielen Konflikten sogenannte gewalttätige Non-State Actors beteiligt, also zum Beispiel Terroristen, Drogenbarone und Extremisten. Die haben wenig Respekt für das humanitäre Völkerrecht.
Hilfsorganisationen müssen aber versuchen, auch mit ihnen umzugehen, um einen Zugang zur hilfsbedürftigen Bevölkerung zu bekommen. Das bedeutet ein hohes Risiko für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann gibt es noch ganz andere Schwierigkeiten, die mehr mit den Organisationen selbst zu tun haben.
Welche sind das?
Wir haben die Neigung, humanitäre Hilfe als normativ gerechtfertigt anzusehen. Ihre Legitimität ist durch ihre menschlichen Ziele gegeben. Keine Frage, Hilfsorganisationen machen wichtige Arbeit, und wir können heilfroh sein, dass es sie gibt. Aber wir werden darüber blind für die aktuelle Politik der Organisationen.
Wir übersehen oft, dass die Effektivität der humanitären Hilfe und die Qualität ihrer Arbeit höher sein könnten. Die einzelnen Handlungen werden nämlich oft durch andere Einflüsse bestimmt. Zum Beispiel von den Interessen der Geldgeber oder vom Ehrgeiz einzelner Mitarbeiter. Aber auch das Ziel der Organisation, weiter zu wachsen, und persönliche Probleme der Mitarbeiter tragen ihren Teil bei, genauso wie korrupte Eliten vor Ort. Wir müssen kritischer darauf gucken.
Viele Helfer sind jahrelang vor Ort. Verliert man da nicht seine Neutralität?
Doch, es passiert oft, dass die Helfer Teil des Konfliktes werden. Sie müssen abwägen zwischen Unparteilichkeit und der Notwendigkeit, politische Unterstützung von und Zusammenarbeit mit Regierungen zu erhalten.
Manche Regimes haben aber korrupte oder kriminelle Absichten und sehen die humanitäre Hilfe als erneuerbare Ressource für Lebensmittel, Medikamente und Geld. Sie sehen die humanitären Organisationen entweder als Bedrohung, wenn ihre Opponenten davon profitieren, oder als Chance, um selbst besser werden zu können. Entweder sie kidnappen oder ermorden Helfer und bekommen durch Erpressung, was sie wollen. Oder sie lassen die Helfer nicht direkt mit den Hilfsbedürftigen zusammen und behalten die Hilfsgüter für sich.
Eine andere Art des Missbrauchs humanitärer Hilfe ist es, wenn Rebellen oder Regierungen humanitäre Hilfe zulassen, sich aber dem Volk gegenüber damit brüsten. Die Hilfsorganisationen erhöhen manchmal ungewollt die Legitimität mancher Kriegsherren oder korrupter oder inkompetenter Regierungen.
Wie kann die Forschung, die Sie betreiben, dabei helfen, diese Probleme in den Griff zu bekommen?
Wir wollen verstehen, was tatsächlich passiert vor Ort und innerhalb der Organisationen und der Bevölkerung. Dabei geben wir uns viel Mühe, nicht nur die Hilfe, aber auch den ganzen Kontext der Krisen zu verstehen. Wir wollen zum Beispiel dazu beitragen, die Diversität der neuen humanitären Akteure wie Rebellenorganisationen oder neue Geldgeberregierungen wie Indien oder die Türkei besser zu verstehen.
Wir betreiben dann auch Normenforschung: Welche Ziele verfolgen sie im Vergleich zu traditionellen Akteuren? Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen außerdem dazu beitragen, dass Hilfsorganisationen besser in der Lage sind, ihre Hilfe optimaler zu koordinieren und damit den Menschen effektiver helfen zu können.
Ist es eigentlich einfach, die Feldforschung mit der wissenschaftlichen Karriere in Einklang zu bringen?
Das Problem ist, dass du am besten mehrere Jahre vor Ort sein musst, um „dazwischen“ zu kommen. Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und genug über die Strategien der lokalen Partner und Konfliktparteien zu lernen. Das bedeutet aber in den meisten Fällen, dass du in der Zeit weniger Studien veröffentlichst und somit weniger Drittmittel einwerben kannst. In dieser Hinsicht funktionieren die akademischen Anreize hier nicht so gut.