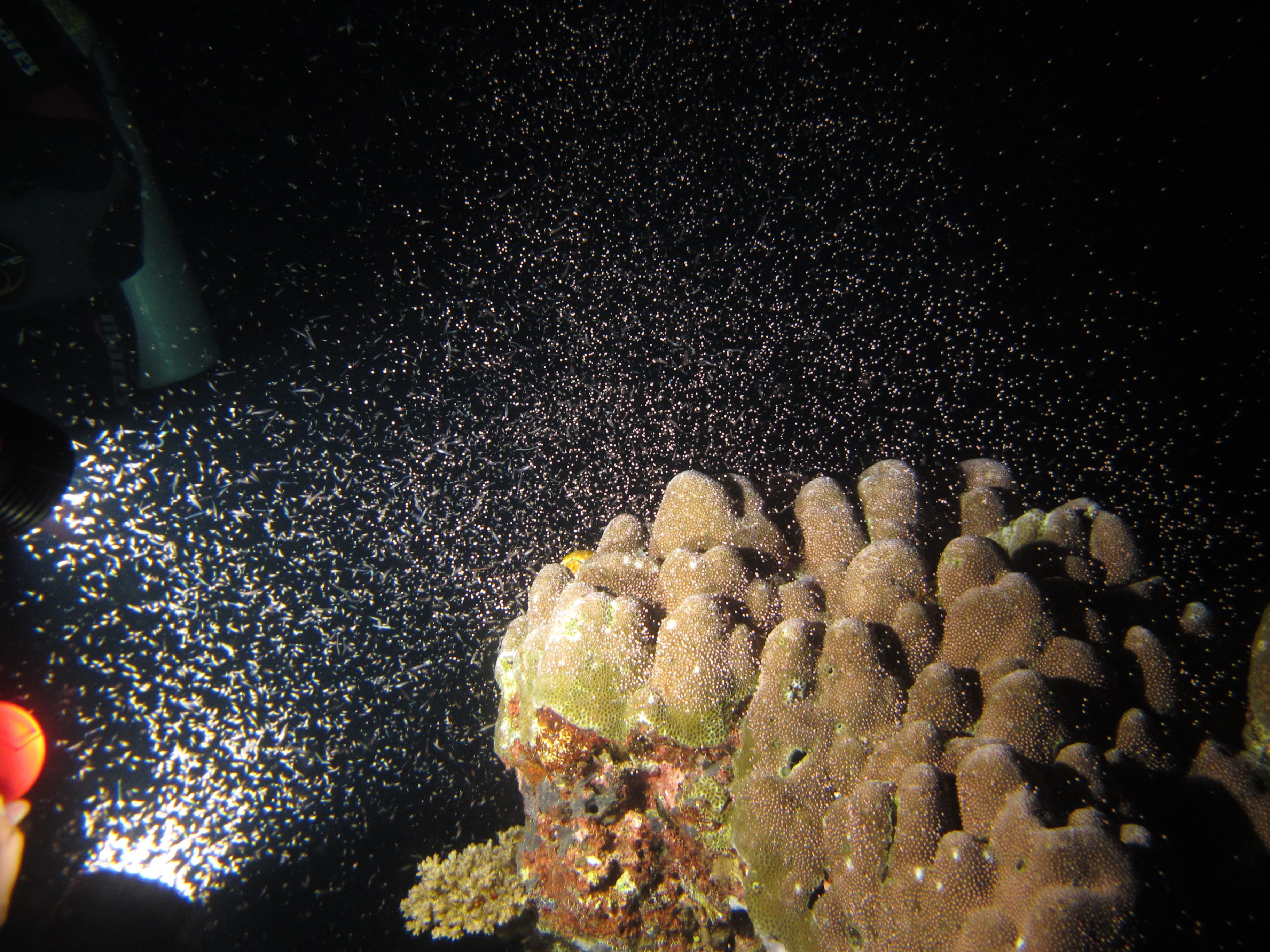17. November
Tag des Weltfriedens
Man sollte meinen, die Welt habe aus den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts gelernt. Und tatsächlich besagen Statistiken, dass es weniger Kriege gibt. Die Medien vermitteln aber ein anderes Bild. Wie passt das zusammen?
Das haben wir Prof. Dr. Dennis Dijkzeul vom Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) gefragt.
1989, als der Kalte Krieg zu Ende war, veröffentlichte John Mueller „Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War“. Er argumentierte, dass trotz oder vielleicht dank zweier Weltkriege im zwanzigsten Jahrhundert der große Krieg unter den Industrienationen allmählich keine politische Option mehr sei. Er war vorsichtig optimistisch, dass die „dritte Welt“ sich ähnlich entwickeln würde.
Und tatsächlich erschienen in den vergangenen Jahren regelmäßig Studien, die belegen, dass es heutzutage weniger Kriege gibt als früher. Wenn man aber heute den Fernseher einschaltet, sieht man ein ganz anderes Bild: Die Kriege der jüngsten Zeit wie in der Ukraine, dem Gaza-Streifen, dem Süd-Sudan und in Irak-Syrien vermitteln den Eindruck, dass Kriege heute häufiger geworden sind. Wie passt das zusammen?
Genauer Blick in die Statistiken
Es lohnt ein genauer Blick in die Statistiken: Obwohl die Zunahme der humanitären Krisen anderes vermuten lässt, haben wichtige Studien der vergangenen Jahre statistisch belegt, dass der Anteil von durch Kriegsführung verursachten Todesfällen von 15 bis auf drei Prozent der Bevölkerung zurückgegangen ist, und dass die Zahl der Konflikte mit hoher Intensität (diejenigen mit mindestens 1.000 Todesfällen pro Jahr) abgenommen hat.
Konflikte niedriger Intensität, meistens auf der Südhalbkugel, haben indessen zugenommen.
Nur die Getöteten werden gezählt, nicht die Verwundeten
Das Problem dieser Statistiken ist, dass sie sich fast ausschließlich auf einen historischen Rückgang der Zahl der im Kampf Getöteten beziehen, der gleichzeitig mit dramatischen Verbesserungen in der Militärmedizin in den vergangenen zwei Jahrhunderten auftritt. Das bedeutet: Weniger Soldaten sterben im Krieg, aber viele überleben schwer verletzt und müssen später mit einer Behinderung oder einem Trauma weiterleben. Krieg ist heutzutage also weniger tödlich, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er weniger stattfindet.
Außerdem bleiben die vielen Probleme der Zivilisten und wichtige geopolitische Änderungen in diesen Statistiken außen vor. Die Statistiken fassen das durch Kriege verursachte Leid nicht mehr zusammen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Statistiken weder die Folgen noch die Ursachen moderner Konflikte aufgreifen.
Ein Definitionsproblem
Außerdem greift die Definition von Krieg als Konflikt hoher Intensität nicht, um die jüngsten Konflikte gut zu verstehen. In vielen weniger intensiven Konflikten, insbesondere chronischen Konflikten, wird das humanitäre Völkerrecht nicht mehr eingehalten.
Das bedeutet, dass Kämpfer außer Gefecht gestellt sind und Zivilisten weniger Schutz empfangen als vorher. Sie werden nicht unbedingt sterben und in den Statistiken auftauchen, aber Gewalt, Flucht, Hunger, Destruktion, Unsicherheit usw. haben negativen Einfluss auf ihr Leben.
Hintergründe
Zudem lässt sich die hohe Anzahl der Flüchtlinge nicht unbedingt auf die vordergründigen Kriege zurückführen. Bei vielen Flüchtlingen und Migranten wissen wir nicht, ob die Ursache ihrer Mobilität Krieg, Klimawandel oder Armut ist. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig; wie genau, ist aber oft unklar und unbekannt.
Die USA als „globaler Cop“ sind nach Afghanistan, Irak und Syrien weniger glaubwürdig als vorher. Sie schrecken Staaten wie Russland und China von möglichen Kriegsverbrechen oder Unterdrückung der eigenen Bevölkerung weniger ab. Ein Nebeneffekt des weltweiten „Kriegs gegen den Terror“ ist zudem, dass gewisse Regimes die Unterdrückung ihrer binnenländischen Opponenten als Kampf gegen „Terroristen“ oder „Extremisten“ abtun.
Extremisten, nicht nur muslimische, sind aktiver denn je. Im Westen denken wir sofort an Al Qaida und den Islamischen Staat, vergessen aber zu oft buddhistische Extremisten, jüdische Siedler und Tempelbauer sowie konservative Christen.
Gefallenenstatistiken reichen nicht mehr aus
Die Statistiken der Gefallenen reichen als Indikation nicht mehr aus, um das Ausmaß und die Intensität der bewaffneten Konflikte nachzuvollziehen. Die Art der Kriege und des Leidens ändern sich mit der Zeit.
Wir brauchen andere Indikatoren, um die Ursachen und Folgen der Kriege der jüngsten Zeit besser zu verstehen.