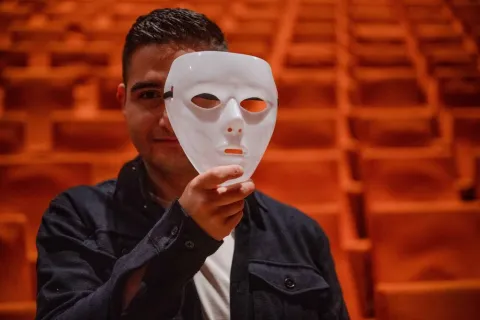Kriminologie
Die Angst der Kosovaren
Wie die Bevölkerung im Kosovo die eigene Sicherheit einschätzt, mutet kurios an. Diese Einschätzung zu kennen, ist unverzichtbar bei der Hilfe zum Staatsaufbau.
Es sind nicht die organisierte Kriminalität, der Drogen-, Menschen- und Waffenhandel, durch die sich die Menschen im Kosovo bedroht fühlen, sondern vor allem Straßenhunde und -verkehr.
Das ist das Ergebnis einer Befragung durch Wissenschaftler des Lehrstuhls für Kriminologie der RUB, die sie in einem EU-Projekt durchgeführt haben. Ihr Ergebnis soll helfen, die Sicherheit im Land zu verbessern, indem man sie nicht autoritär von oben durchsetzt, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung vorbeugend arbeitet.
Sicherheitsproblem für die EU
Die Europäische Union widmet dem Kosovo besondere Aufmerksamkeit, denn es liegt unmittelbar an ihrer Außengrenze und bedeutet ein Sicherheitsproblem: Der jüngste Staat Europas gilt als Dreh- und Angelpunkt für organisierte Kriminalität, Drogen-, Menschen- und illegalen Waffenhandel in die EU.
[Infobox:1]
Bei ihrem Engagement im Kosovo geht es der EU nicht nur darum, Gefahren zu bekämpfen, die von dort für die Union ausgehen. Das Land soll auch als Beispiel dafür dienen, dass Staatsaufbau und die Bekämpfung von Fluchtursachen funktionieren können.
Seit Ende des Kosovokonflikts 1999 hat die internationale Gemeinschaft über vier Milliarden Euro an Entwicklungshilfe ins Kosovo investiert. Zudem hat die EU seit 2008 mit dem Projekt Eulex die umfangreichste Rechtsstaatlichkeitsmission der Geschichte ins Leben gerufen. Sie soll dem Land beim Aufbau von Polizei, Justiz und Verwaltung helfen.
Zweifelhafter Erfolg
Allerdings mit zweifelhaftem Erfolg: Das Kosovo gilt immer noch als einer der korruptesten Staaten Europas. Die politische Elite und die organisierte Kriminalität sind bis heute eng verwoben. Das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung liegt zwischen nur 300 und 400 Euro im Monat.
Dies sind nur einige Gründe dafür, dass im Jahr 2015 über hunderttausend Menschen und damit fast ein Zehntel der Gesamtbevölkerung des kleinsten Balkanstaats in der EU Asyl beantragten.
Zivilbevölkerung einbeziehen
„Die Außenperspektive allein ist sicher nicht erfolgversprechend“, sagt dazu Dr. Robin Hofmann vom Team des Lehrstuhls für Kriminologie. Seine Forschung im EU-Projekt „Information and Communication Technologies for Community Oriented Policing“ setzt sich mit dem sogenannten Community Policing auseinander.
„Diese Form der Polizeiarbeit versucht, die Zivilbevölkerung in die Gewährleistung von Sicherheit einzubeziehen, anstatt von oben autoritär die Sicherheit durchzusetzen.“ Es geht dabei nicht allein darum, Straftaten aufzuklären, sondern gemeinsam vorbeugend zu arbeiten.

Für ihre Forschung haben die Wissenschaftler der RUB in der Region Bosnien, Serbien, Kosovo bislang rund 70 Interviews mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren geführt. Darunter sind Repräsentanten von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft, Forscher, politische Aktivisten, aber auch Polizei, Vertreter von Eulex, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie der UN.
Dabei kam heraus, dass sich die Menschen vor allem durch die wachsende Zahl von Straßenhunden bedroht fühlen, direkt gefolgt von den Gefahren des Straßenverkehrs. „Und wer das Kosovo einmal besucht hat, der kann diese Einschätzung nachvollziehen“, sagt Prof. Dr. Thomas Feltes, Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie.
Für ihn ist das Ergebnis ein weiterer Beleg dafür, wie sehr die Innen- und Außenwahrnehmung in Sachen Sicherheit auseinanderklaffen kann. „Das ist übrigens überall so, auch bei uns in Bochum, wie unsere jüngste Studie gezeigt hat“, stellt der Kriminologe fest.
Nicht nur eigene Interessen in den Mittelpunkt stellen
Diese praxisnahe Forschung ist besonders wertvoll für die EU-Außen- und Sicherheitspolitik, denn internationale Polizeimissionen sind ein zunehmend wichtiger Bestandteil.
„Will man erfolgreich eine Polizei aufbauen, dann darf es nicht allein um einseitige Sicherheitsinteressen der Entsendestaaten gehen“, betont Robin Hofmann. „Viel stärker als bisher muss diese zivilgesellschaftliche Dimension von Sicherheit in Post-Konflikt-Staaten einbezogen werden, die sich im Umbruch befinden.“
[Infobox:2]