
Chemie
Prozesse an industriellen Elektroden besser verstehen
Die Erkenntnisse könnten künftig helfen, Kohlendioxid einzusparen.
Für die industrielle Produktion von Chlor kommen seit einiger Zeit Elektroden zum Einsatz, die weniger Strom verbrauchen als herkömmliche Verfahren. Die Methode erfordert Sauerstoff, der in heiße, hoch konzentrierte Natronlauge eingeleitet wird – worin er schlecht löslich ist. Es ist bisher unklar, wie die industriellen Stromdichten unter diesen Bedingungen erreichbar sind.
„Die Elektroden werden seit Jahren industriell eingesetzt, aber man versteht nicht, warum sie überhaupt funktionieren können“, erklärt Wolfgang Schuhmann vom RUB-Zentrum für Elektrochemie und Mitglied im Exzellenzcluster Resolv.
Wolfgang Schuhmann, Alexander Botz, Denis Öhl und weitere Kollegen der RUB und der Technischen Universität Clausthal haben neue Erkenntnisse über die Abläufe an den Elektroden gewonnen. Das Team beschreibt sie in der Zeitschrift Angewandte Chemie, online veröffentlicht am 3. August 2018.
Reaktionsbedingungen ändern sich ständig
In der Umgebung der Elektrode, an der die Chlor-Produktion stattfindet, treffen drei Phasen aufeinander: fest, flüssig und gasförmig. Bislang haben Forscher hauptsächlich die Konzentration des reagierenden Sauerstoffs in der Umgebung der festen Phase untersucht und Modelle entwickelt, die diesen Parameter für die hohe Stromdichte verantwortlich machen.
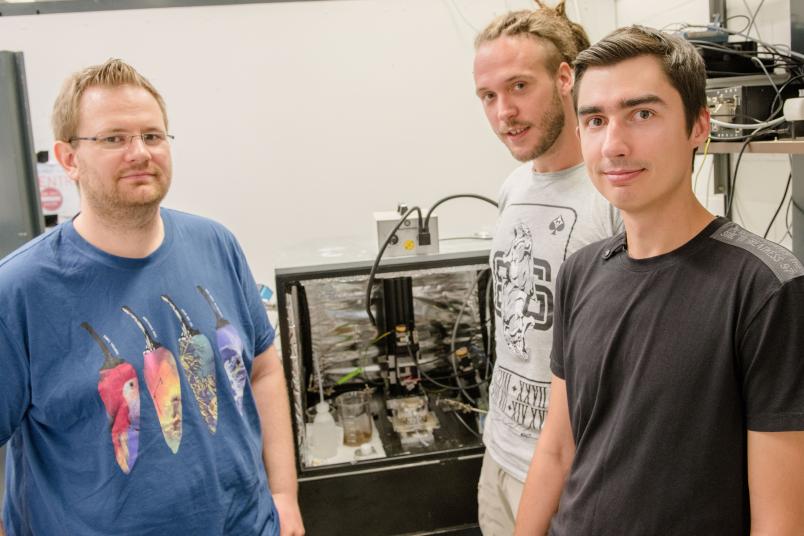
Für die aktuelle Studie analysierten die Bochumer Wissenschaftler nun die flüssige Phase und stellten fest: Die Konzentration von Wasser und Hydroxid-Ionen an der Elektrodenoberfläche schwankt im Lauf der Reaktion extrem stark und nicht überall gleichmäßig.
CO2 binden
„Wir haben schon vor Jahren vermutet, dass es gravierende lokale Konzentrationsschwankungen im Inneren der Elektrode geben muss, die zu den hohen Stromdichten beitragen könnten“, schildert Schuhmann. „Diese Untersuchungen sind essenziell für die Entwicklung von Gasdiffusionselektroden, die künftig eine große Bedeutung beim Binden von CO2 aus der Luft haben werden und so einen Beitrag zu einer Verringerung der Emission von Treibhausgasen haben.“
„Diese drastischen Veränderungen sind bisher nicht in den Modellen berücksichtigt, die die Reaktion abbilden sollen“, sagt Alexander Botz. „Für künftige Optimierungen solcher Elektroden sind die Ergebnisse von enormer Bedeutung.“





