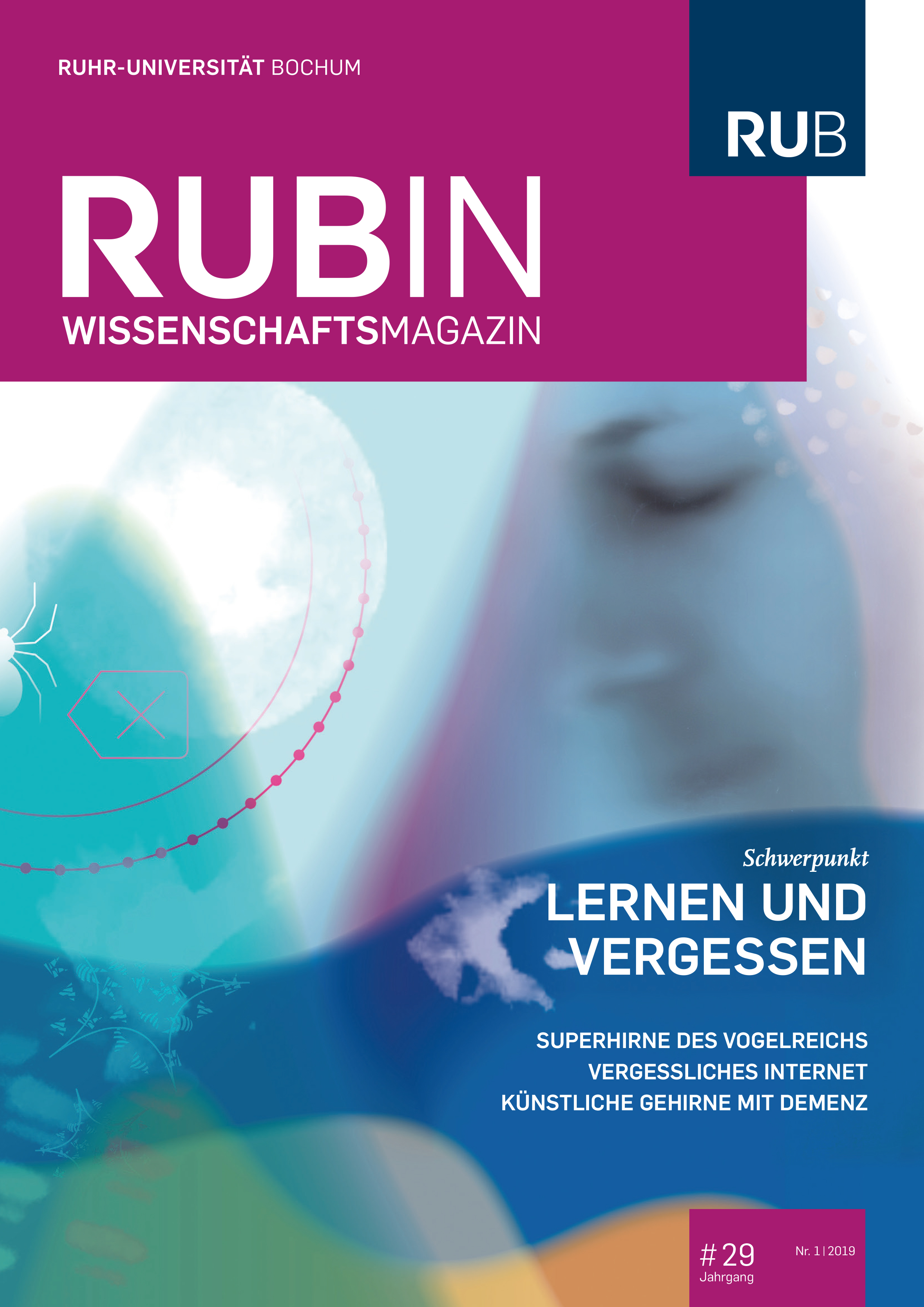Wissenshäppchen
Warum trocknet Kunststoff in der Spülmaschine so schlecht?
Geschirr trocken. Besteck trocken. Gläser trocken. Plastikschüssel nass.
Wer einmal eine Spülmaschine angeschafft hat, will sie in der Regel nie wieder hergeben. Sie spart viel Zeit und lästige Arbeit. Anstellen, aufmachen, abkühlen lassen, ausräumen. Nur die Kunststoffgegenstände brauchen eine Extrabehandlung. Während Messer und Teller längst trocken sind, hängen an den Plastikdosen immer noch die dicken Wassertropfen. Was ist anders bei diesem Material?
„Die meisten Spülmaschinen trocknen, indem sie das Geschirr und Besteck durch heiße Luft oder heißes Wasser aufwärmen. Das Wasser verdunstet dann an der Oberfläche der Gegenstände“, sagt Prof. Dr. Karina Morgenstern vom RUB-Lehrstuhl für Physikalische Chemie I. Kunststoff hat aber eine geringe Wärmeleitfähigkeit. „Er wird viel langsamer warm als Metall oder Porzellan“, so Morgenstern. An einer Kunststoffoberfläche verdunstet somit in der gleichen Zeit weniger Wasser als zum Beispiel an einer Metalloberfläche.
Nicht zu ändern
Für Quarzglas beträgt die Wärmeleitfähigkeit rund 1,5 Watt pro Meter mal Kelvin. Porzellan kommt auf einen Wert von etwa 1. Für Kunststoffe wie Polypropylen hingegen liegt der Wert gerade einmal bei 0,2. Manche Metalle können eine Wärmeleitfähigkeit von mehreren Hundert Watt pro Meter mal Kelvin besitzen; Edelstahl schafft nicht ganz so viel, erreicht aber immerhin Werte von 15 bis 20 – was in Zahlen zeigt, warum man sich am Besteck vortrefflich die Finger verbrennen kann, wenn man die Spülmaschine zu früh ausräumt.
Die Zahlen zeigen auch: Dass Plastikteile im Geschirrspüler so schlecht trocknen, liegt an einer grundsätzlichen Eigenschaft des Kunststoffs – ändern kann man das nicht. Man muss zum Handtuch greifen.
Mineral kann helfen
Abhilfe versprechen aber auch Maschinen, die mit einem neuen Trocknungsprinzip daherkommen. Sie beinhalten am Boden ein poröses Mineral aus der Zeolith-Familie, das das Wasser bindet. Zeolithe sind typischerweise Aluminiumsilikate. Das Silikatgerüst ist negativ geladen, und an den Innenseiten der Poren befinden sich positiv geladene Ionen. „Diese sind wasseranziehend, sie möchten sich rundherum mit Sauerstoffatomen umgeben“, erklärt Dr. Bernd Marler vom RUB-Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik. Ein Teil der Sauerstoffatome wird durch das Silikatgerüst bereitgestellt, der Rest durch die Wassermoleküle.
„Ein wasserfreier Zeolith ist ein Trockenmittel, das sich sofort mit Wasser belädt, wenn man es ungeschützt der normalen Luft aussetzt“, erklärt Marler.
Wasser bleibt gespeichert
Um das Wasser mithilfe eines Zeolithen aus der Spülmaschine zu entfernen, sind daher keine hohen Temperaturen notwendig. Die feuchte Luft wird über das Mineral geleitet, das das Wasser aufnimmt. Durch den Prozess der Wasseraufnahme am Zeolithen erwärmt sich die Luft ein wenig. Sie wird zurück zum Geschirr geleitet, nimmt erneut Feuchtigkeit auf und strömt dann zurück zum Zeolithen, wo die Feuchtigkeit wieder entzogen wird. So wird das Geschirr Schritt für Schritt getrocknet. „Da primär über die trockene Luft und nicht über Wärme getrocknet wird, spielt die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit von Metall, Kunststoff und Porzellan für diesen Mechanismus kaum eine Rolle“, resümiert Marler.
Das entzogene Wasser bleibt bis zum nächsten Spülvorgang gespeichert. Erst bei hohen Temperaturen gibt der Zeolith es wieder ab – nämlich dann, wenn die Maschine beim Vorspülen aufgeheizt wird.