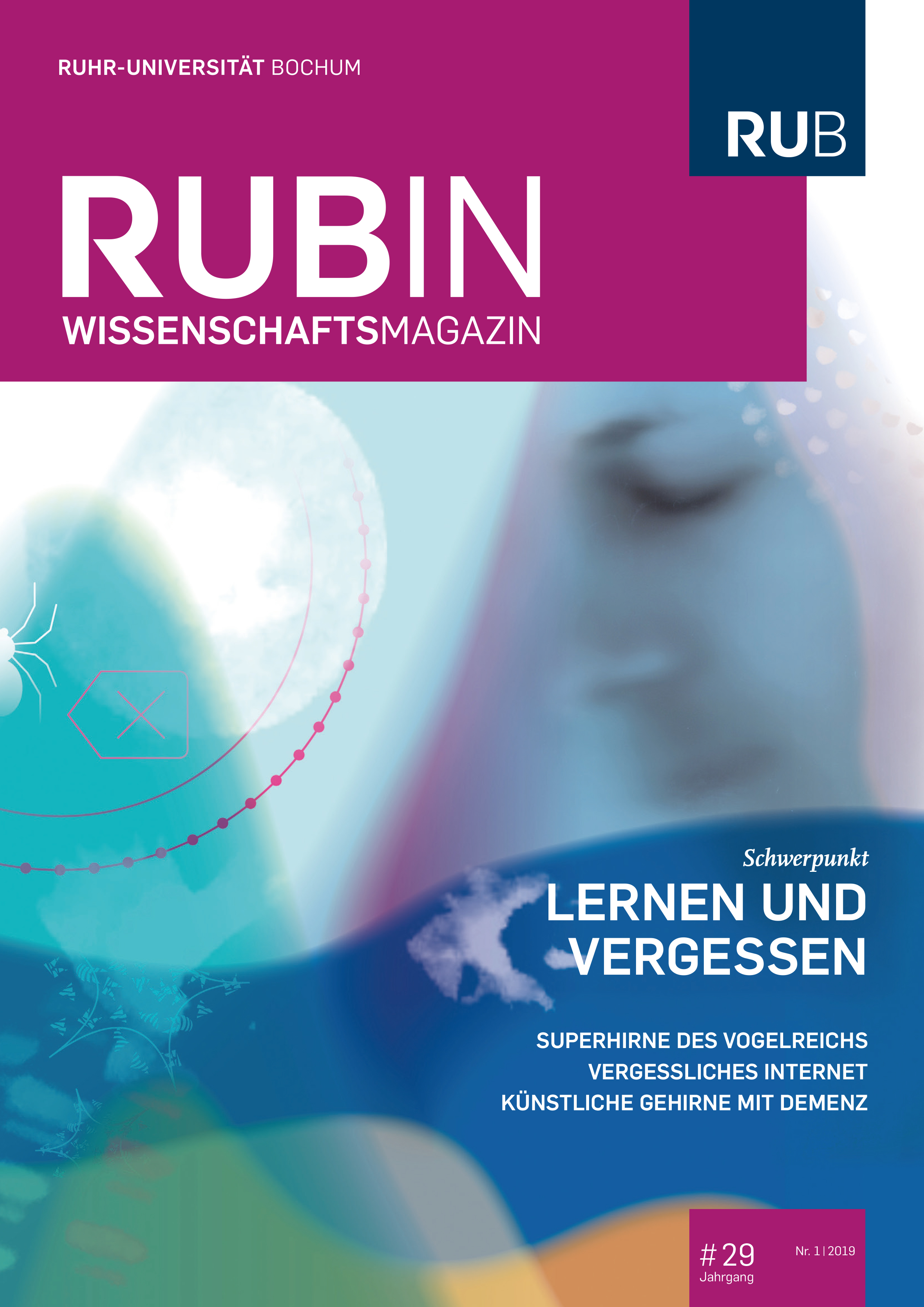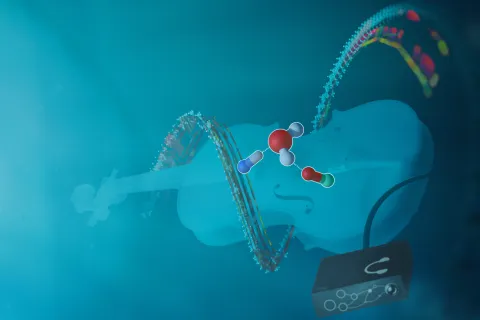Chemie
Silbernanopartikel – ein Problem für die Umwelt?
Bislang hat es keine Methode gegeben, um den Einfluss der Partikel zu untersuchen. Erste Ergebnisse mit einem neuen Verfahren zeigen, dass sich die Teilchen anders verhalten als gedacht.
Silberteilchen wirken antibakteriell und entzündungshemmend. Daher sind sie mittlerweile vielfältig im Einsatz, zum Beispiel als Beschichtung von Wundauflagen, als Geruchshemmer in Sportkleidung oder auch in Verpackungen von Lebensmitteln. Von dort gelangen sie regelmäßig in die Umwelt. „Wenn Sportkleidung gewaschen wird, lösen sich pro Waschgang 50 Prozent der enthaltenen Silberpartikel im Wasser“, sagt Prof. Dr. Kristina Tschulik, Chemikerin im Exzellenzcluster Ruhr Explores Solvation an der RUB. „Letztendlich landen sie im Meer“. Was dort mit ihnen passiert, ist bislang weitestgehend unbekannt.
Das liegt daran, dass die winzigen Partikel von wenigen Nanometern Größe schwer zu untersuchen sind – erst recht, wenn sie in geringer Konzentration in einer komplizierten Umgebung wie dem Meerwasser vorliegen. „Hier gibt es viele Störquellen wie Salze oder Algen“, erklärt Tschulik. Herkömmliche Methoden zur Analyse von Nanopartikeln kommen damit nicht zurecht, denn sie funktionieren meist im Hochvakuum.
Anti-Mundgeruch-Spray im Test
Kristina Tschuliks Arbeitsgruppe für Elektrochemie und Nanoskalige Materialien hat ein neues Verfahren entwickelt, das das ändert. Es kann einzelne Nanopartikel in Lösung aufspüren und analysieren, was dort mit ihnen passiert. Dazu kombinierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein zuvor etabliertes elektrochemisches Verfahren mit einer spektroskopischen Methode.
Dass das Verfahren robust gegenüber Störquellen ist, zeigten die Forscherinnen und Forscher in einem ersten Schritt mit Wasserproben aus einem unberührten kanadischen Fjord. In diesem Wasser waren zwar Salze, Algen und andere Störfaktoren enthalten, aber keine industriellen Verunreinigungen.
Diese fügten die Forscherinnen und Forscher im Labor selbst hinzu: Sie kauften ein Silbernanopartikel-Spray im Internet, das für die Desinfektion von Besteck und als Mittel gegen Mundgeruch bei Hunden angeboten wurde. Dieses sprühten sie in das Fjord-Wasser und untersuchten mit der elektrochemischen Methode, ob sie die Partikel detektieren konnten. Das gelang.

Mit der kombinierten spektro-elektrochemischen Methode analysierten sie in weiteren Studien, was mit Silberpartikeln in salzhaltigem Wasser passiert. Bislang war man davon ausgegangen, dass die Partikel als Silberionen im Wasser gelöst werden.
Partikel verklumpen
Diese Annahme bestätigte sich nicht; stattdessen verklumpten die Partikel und reagierten zu Silberchlorid. „Sie würden also vermutlich zu Boden sinken und sedimentieren“, folgert Tschulik. „Dann sind sie zwar aus dem Meerwasser entfernt, aber man müsste überlegen, welche langfristigen Folgen diese Schwermetallablagerungen für Meeresbewohner haben könnten, die in Bodennähe leben.“

Je mehr wir Nanopartikel einsetzen, desto wichtiger ist es, dass wir ihre Auswirkungen abschätzen können.
Kristina Tschulik
Weil es zuvor kein Verfahren gab, mit dem sich Nanopartikel in natürlichen Umgebungen untersuchen lassen, ist wenig über ihre Einflüsse auf die Umwelt bekannt. „Basierend auf einem solchen einzelnen Ergebnis sollte man nicht in Panik verfallen“, meint Kristina Tschulik und erinnert daran, dass verschiedene Nanopartikel sich sehr unterschiedlich verhalten können – man kann also nicht aus wenigen Studien auf sämtliche Nanopartikel schließen. Aber: „Je mehr wir Nanopartikel einsetzen, desto wichtiger ist es, dass wir ihre Auswirkungen abschätzen können“, ergänzt die Forscherin.
Bislang keine Kontrollpflicht
Mit der Methode von Tschuliks Gruppe wäre das möglich – nicht nur im Meerwasser, sondern zum Beispiel auch im Prozessabwasser von Industrieunternehmen. „Solange es jedoch keine etablierten Messmethoden und folglich keine gesetzliche Pflicht gibt, solche Partikel nachzuweisen, tun die Firmen das natürlich auch nicht“, weiß Tschulik. Sollte der Gesetzgeber eine solche Kontrollpflicht einführen, ist die Basis zum Bau geeigneter Sensoren jetzt vorhanden.