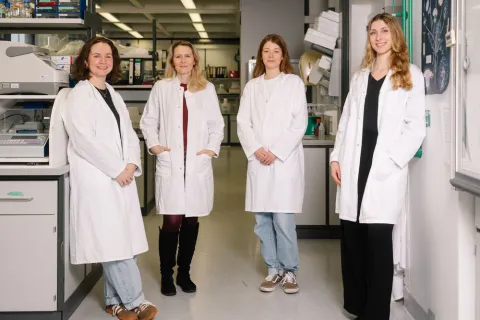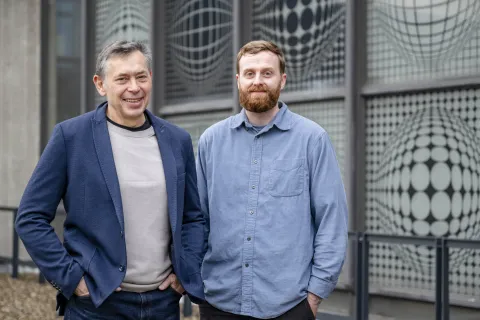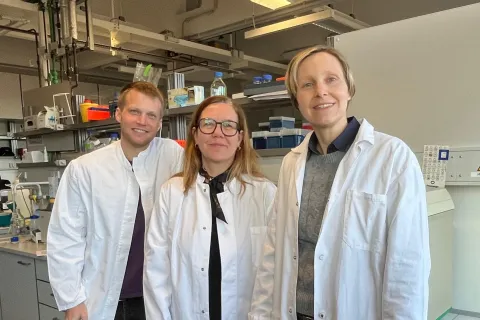Psychologie
Angst verlernen
Wenn Ängste vor Spinnen, Höhe oder dem Fliegen so extrem sind, dass sie Menschen im Alltag behindern, kann eine Verhaltenstherapie sinnvoll sein. Sie funktioniert gut, könnte aber wohl noch effizienter sein.
Beim Anblick einer Spinne wird vielen Menschen mulmig zumute. Direkten Körperkontakt mit den Achtbeinern vermeiden sie erst recht. Dabei ist die Angst vor Spinnen in den meisten Gegenden der Welt heute unbegründet; in Deutschland beispielsweise gibt es keine Art, die Menschen ernsthaft gefährlich werden kann. Dennoch leiden manche Leute unter einer extremen Angst vor den Tieren. Wie man Phobien wirksam und nachhaltig behandeln kann, erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Zentrum für Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum.
Ein bewährtes Mittel ist die Konfrontationstherapie, bei der sich der oder die Betroffene unter Anleitung des Therapeuten bewusst in die angstauslösende Situation begibt. „Die Konfrontationstherapie ist schon sehr gut, viel wirksamer als medikamentöse Therapien bei Angststörungen“, sagt Prof. Dr. Armin Zlomuzica vom Lehrstuhl Klinische Psychologie und Psychotherapie. „Aber es gibt immer noch Luft nach oben.“ Denn nicht alle Behandelten profitieren gleich stark von diesem Ansatz. Die Bochumer Gruppe untersucht daher, wie sich die Effizienz der Therapie steigern lässt, und nutzt dafür das Modell des Extinktionslernens. Es basiert auf der Annahme, dass die Angst zumindest teilweise erlernt ist.
Stresshormon beeinflusst Ergebnisse
Solche erlernten Ängste lassen sich in Konditionierungsexperimenten mit gesunden Probandinnen und Probanden nachstellen: Sie bekommen einen eigentlich neutralen Reiz präsentiert, zum Beispiel ein abstraktes Muster, auf das eine aversive Stimulation folgt, etwa ein unangenehmer Strompuls. Im Lauf der Zeit lernen die Teilnehmer, das Bild zu fürchten. Wird das Bild dann eine Weile ohne den Strompuls präsentiert, lernen die Probanden, dass sie keine Angst mehr davor haben müssen. Genau dieser Mechanismus, das sogenannte Extinktionslernen, liegt der Konfrontationstherapie zugrunde.
„Verschiedene Studien haben gezeigt, dass man die Extinktion bei gesunden Probanden durch die Gabe eines Medikaments, nämlich durch das Stresshormon Cortisol, beschleunigen oder besser verfestigen kann“, weiß Armin Zlomuzica. Erste Untersuchungen mit Patienten zeigen auch positive Effekte beim Therapieerfolg. In diesen Studien nahmen die Patientinnen und Patienten das Medikament stets vor der Intervention ein. Die Bochumer Psychologen testeten nun, was passiert, wenn sie Cortisol nach der Therapie verabreichten. Die Idee: So könnten sie das Pharmakon gezielt nach erfolgreichen Konfrontationen mit dem angstauslösenden Objekt einsetzen und somit nur die positiven Therapieerlebnisse verfestigen, wobei Zlomuzica betont, dass es keine klaren Kriterien dafür gibt, wann eine Therapie gut und wann sie schlecht gelaufen ist.
Konfrontationstherapie im Test
Diese Theorie testeten die Wissenschaftler an einer Gruppe von rund 50 Menschen mit ausgeprägter Spinnenangst. Die Hälfte erhielt nach der Konfrontationstherapie einmalig eine Cortisol-Tablette, die andere Hälfte ein Plazebo. Vor und nach der Konfrontation erfassten die Forscher, wie stark sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Spinnen fürchteten. Die Patienten schätzten ihre Angst zum einen subjektiv ein; zum anderen absolvierten sie einen Annäherungstest, um ein objektives Maß für ihre Furcht zu erhalten.

Manche Menschen können nicht so nah an das Terrarium herangehen, dass sie die Spinne in all ihren Details anschauen können.
Armin Zlomuzica
Dabei präsentiert der Therapeut oder die Therapeutin eine Spinne in einem Terrarium und bittet den Patienten, sich so weit wie möglich an das Tier anzunähern. „Spinnenphobiker trauen sich beispielsweise nicht, die Hand von außen an die Glasscheibe zu legen, auch wenn sie nicht mit der Spinne in Kontakt kommen können“, beschreibt Armin Zlomuzica. „Manche Menschen können auch nicht so nah an das Terrarium herangehen, dass sie die Spinne in all ihren Details anschauen können.“

Unmittelbar nach der Therapie konnten sich die meisten Patienten der Spinne stärker annähern als vorher. „Dann trauen sie sich zum Beispiel, die Hand in das Terrarium zu halten oder die Spinne sogar auf den Arm zu nehmen“, erklärt Zlomuzica. Sein Team interessierte sich aber vor allem für die langfristigen Effekte der Intervention.
Daher wiederholten die Psychologen den Annäherungsversuch einen Monat und sechs Monate nach der Konfrontationstherapie, und zwar in zwei verschiedenen Kontexten: in dem Raum, in dem die Therapie stattgefunden hatte, und in einem anderen Raum mit einem andersfarbigen Terrarium und einem anderen Versuchsleiter.
Kontext entscheidend
„Beim Extinktionslernen gibt es oft Kontexteffekte“, begründet Zlomuzica das Vorgehen. Die Patienten können das in der Therapie Gelernte also nicht immer auf einen anderen Kontext übertragen. „Dann fürchten sich die Patienten vielleicht weniger vor Spinnen, wenn sie in dem Raum sind, in dem sie die Konfrontation erlebt haben“, so der Therapeut. „Aber wenn sie zuhause eine Flasche Wein aus dem Keller holen und eine Spinne sehen, kommt die extreme Angst zurück.“ Ziel der Behandlung sei es allerdings, dass die Angst generell schwindet, egal wo die Patienten den Tieren begegnen.
Genau das wird jedoch durch Cortisol erschwert. „Unsere Studie hat gezeigt, dass das Gelernte durch das Medikament viel stärker an den Kontext gebunden wurde, was langfristig natürlich nicht gut ist“, erklärt Armin Zlomuzica. Die Cortisol-Einnahme machte es also wahrscheinlicher, dass die Patienten einen Rückfall erlitten, wenn sie der Spinne in einem neuen Kontext begegneten. Eine Cortisol-Gabe nach der Konfrontationstherapie scheint somit für die Betroffenen nicht vorteilhaft zu sein. „Auch das ist ein wertvolles Ergebnis“, folgert Zlomuzica. „Wir werden nun weitere Versuche machen, in denen wir den Patienten das Medikament vor der Konfrontation verabreichen.“
Intervention ohne Medikament
Sein Team untersucht gleichzeitig noch andere Ansätze ohne medikamentöse Intervention. So zeigte die Bochumer Gruppe zunächst an gesunden Probanden, dass eine gesteigerte Selbstwirksamkeit das Extinktionslernen fördern kann. „Jeder Mensch hat eine wahrgenommene Selbstwirksamkeit“, erklärt Zlomuzica. „Es ist unsere Selbsteinschätzung, wie gut wir in bestimmten Situationen mit einer Aufgabe oder Herausforderung umgehen können.“
Leute mit Angststörungen erwarten von sich selbst, mit Angstsituationen nicht umgehen zu können; ihre subjektiv empfundene Selbstwirksamkeit ist gering. Ob es für die Therapie förderlich ist, die Selbstwirksamkeit gezielt zu steigern, untersuchten die Forscher in einer Studie mit Menschen, die an Höhenangst litten. Zu diesem Zweck baten sie die Teilnehmer nach der Konfrontationstherapie, sich gezielt an das gemeisterte Erlebnis zu erinnern.

Die Konfrontationstherapie erfolgte in der virtuellen Realität, in der die Teilnehmer das Oberhausener Gasometer besteigen mussten. Um zu überprüfen, wie wirksam die virtuelle Intervention war, gingen die Therapeuten anschließend mit den Patienten auf einen realen Kirchtum.

Entgegen ihrer Erwartung kommt aus der Konfrontation etwas Gutes heraus.
Armin Zlomuzica
„Vor der Intervention gehen die Patienten davon aus, dass die Konfrontation mit der Höhe in einer Katastrophe enden wird“, erzählt Zlomuzica. „Entgegen ihrer Erwartung kommt dann aber etwas Gutes dabei heraus, sie erleben selbstwirksame Erfahrungen.“ Genau auf diese im positiven Sinne verletzte Erwartung weisen die Therapeuten gezielt hin, was in einer gesteigerten Selbstwirksamkeit mündet. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Patienten längerfristig von der Therapie profitieren.
Beide Studien sind eingebettet in einen großen Forschungsverbund, den Sonderforschungsbereich 1280 an der RUB, der sich in den kommenden Jahren mit weiteren bislang unerforschten Facetten des Extinktionslernens beschäftigen wird.