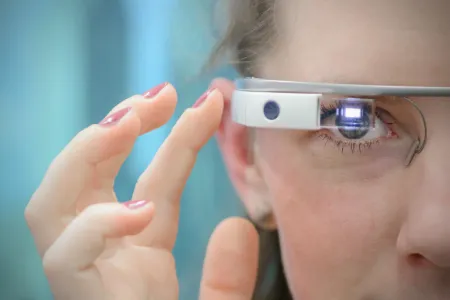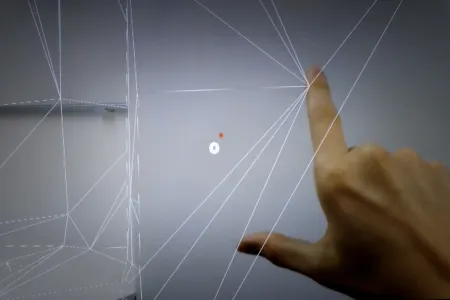Mediennutzung
„Ohne Whatsapp kann ich nicht studieren“
Digitale Medien sind aus dem Studium nicht mehr wegzudenken. In speziellen Situationen sind Stift und Zettel aber immer noch am beliebtesten.
In der Cloud gemeinsam an Dokumenten arbeiten, sich mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen über Messenger-Dienste vernetzen und in Videos die Zusammenhänge erklären lassen, die man in der Vorlesung nicht verstanden hat – die digitale Revolution hat Studierenden eine Fülle von Angeboten gebracht, mit denen sich das Lernen womöglich erleichtern lässt. Aber welche davon nehmen sie tatsächlich in Anspruch, und welche Vor- und Nachteile bringt das mit sich? Mit diesen Fragen hat sich das Projekt „You(r) Study“ beschäftigt, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit März 2017 fördert. Daran beteiligt ist auch das Team von Prof. Dr. Sandra Aßmann vom Institut für Erziehungswissenschaft der RUB. „Es gibt viele quantitative Studien dazu, wie Studierende Medien nutzen“, erzählt sie. Erfasst wird etwa, wie viel Prozent mit Smartphone, Tablet oder Laptop arbeiten. „Wir wollten aber tiefer bohren“, ergänzt Aßmann. Zum Beispiel herausfinden, in welchen Kontexten und zu welchem Zweck die Studierenden welche Technik einsetzen.

Im Bochumer Teilprojekt führten Katharina Mojescik und Mario Engemann Gruppendiskussionen mit Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche durch, um Antworten auf die oben genannten Fragen zu bekommen. Sie sprachen mit Studierenden der Medien- und Erziehungswissenschaft sowie aus Lehramtsstudiengängen an den Universitäten in Bochum und Paderborn. „Das überraschendste Ergebnis für uns war, dass es keine großen Unterschiede im Mediennutzungsverhalten in den unterschiedlichen Studiengängen oder an den Standorten gab“, resümiert Katharina Mojescik. Nicht überrascht waren die Forscherinnen und Forscher hingegen von der Tatsache, dass die digitalen Medien heute aus dem Unialltag nicht mehr wegzudenken sind.
Maßnahmen gegen die Handynutzung
„Die Virtualität ist sehr stark in der Realität angekommen“, sagt Sandra Aßmann. „Die Medien haben einen enormen Stellenwert und sind so normal geworden, dass es den Studierenden komisch vorkommt, überhaupt darüber zu diskutieren, wie sie diese Medien nutzen – das wird gar nicht mehr reflektiert.“ Das Handy ist beispielsweise so normal geworden, dass es schwer ist, ohne auszukommen. Tatsächlich berichteten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie sich Anreize schaffen, es auch mal eine Weile unangetastet zu lassen. So hatten sie beispielsweise eine App installiert, die im Lauf der Zeit auf dem Display einen Baum entstehen lässt – mit umso mehr Blättern, je länger man die Finger vom Gerät gelassen hat.
Viele der digitalen Angebote sehen die Studierenden jedoch als sehr nützlich an. Ein besonderer Stellenwert kommt Instant-Messenger-Diensten wie Whatsapp zu. Gerade zu Beginn des Studiums bieten sie eine Möglichkeit, sich mit den neuen Bekannten zu vernetzen. Sie sind zudem ein sicherer Raum, um Anfängerfragen stellen zu können und sich dadurch im neuen Umfeld sicherer zu fühlen. So treten viele Erstsemester großen Whatsapp-Gruppen mit vielen Teilnehmern bei. Im Lauf des Studiums geht der Trend dann zu kleineren Gruppen, die für die Organisation von Lerngruppen oder zum Vorbereiten eines Referats genutzt werden.
Nicht jeder will immer erreichbar sein
„Allerdings wird Whatsapp auch kritisch gesehen“, weiß Sandra Aßmann. „Nicht jeder hat Lust, ständig von den Kommilitonen kontrolliert zu werden, was er oder sie schon gemacht hat, und auch am Wochenende oder Abend permanent Nachrichten aus den Unigruppen zu empfangen.“ Um das in den Griff zu bekommen, führten einige Studierende Sprechzeiten in ihren Whatsapp-Gruppen ein oder bestimmten einen Admin, der die Gruppe nur zu bestimmten Zeiten aktiv schaltete.
Es gibt allerdings auch aktive Whatsapp-Verweigerer – Studierende, die ihren Kommilitonen gegenüber behaupten, nicht bei dem Messenger-Dienst angemeldet zu sein, weil sie nicht ständig mit universitären Angelegenheiten belangt werden wollen. Wieder andere haben sich nur für das Studium ein Konto eingerichtet: „Wir hören durchaus, dass Leute sagen: ‚Ohne Whatsapp kann ich nicht studieren‘“, zitiert Aßmann.

Neben Whatsapp nahmen auch Soziale Medien einen großen Stellenwert in den Gruppendiskussionen ein, allerdings weniger für organisatorische Zwecke. Stattdessen abonnieren Studierende auf Facebook oder Instagram die Kanäle ihrer Universitäten, um auf dem Laufenden zu bleiben, was auf dem Campus so passiert.
Youtube und Clouddienste kaum relevant
Wenig präsent in den Gruppendiskussionen war Youtube; nur vereinzelt erzählten Studierende, dass sie die Videoplattform nutzen, um sich Inhalte erklären zu lassen. Auch Clouddienste, die das gemeinsame Bearbeiten von Dateien ermöglichen, waren kein großes Thema. Diskutiert wurden hingegen digitale Learning-Management-Systeme wie Moodle – ein Onlinetool, über das Lehrende zum Beispiel Seminar- oder Vorlesungsunterlagen zur Verfügung stellen können. Allerdings standen die Nachteile im Vordergrund. So kritisierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa, dass Dozentinnen und Dozenten sie mit dem Tool kontrollieren könnten, oder dass Moodle keine Benachrichtigungen verschickt, wenn neue Dateien online gestellt wurden.
Das Projektteam analysierte unter Federführung des Bremer Instituts für Informationsmanagement sogar anonymisierte Log-Dateien der Plattform, um herauszufinden, in welchem Umfang und zu welchen Zeitpunkten Moodle genutzt wird. Der anonymisierte Moodle-Datensatz der RUB umfasste 114,2 Millionen Log-Einträge über zwölf Monate und gab Aufschluss über die Aktivitäten der 54.000 Nutzerinnen und Nutzer. Generell schwankte die Nutzung durch die User stark: Zum Vorlesungsbeginn stiegen die Zugriffszahlen sprungartig an; über den Sommer und die Weihnachtspause nahmen sie sehr stark ab. Die meisten Studentinnen und Studenten loggen sich im Durschnitt weniger als einmal am Tag ein.
Vor Prüfungen lieber mit Stift und Zettel
„Auch wenn man Moodle nutzen könnte, um Daten auszutauschen, tummeln sich Studierende dafür eher auf anderen Plattformen, weil diese schlicht komfortabler sind“, erklärt Sandra Aßmann. Sie sieht durchaus auch Nachholbedarf bei den Lehrenden und im Curriculum: „Vermutlich müssten wir zu Beginn des Studiums Kurse anbieten, wie man Moodle sinnvoll nutzen kann“, stellt die Forscherin fest. „Vieles ist derzeit Learning by Doing“. Außerdem wäre es hilfreich, wenn die Plattform komfortabler würde, zum Beispiel einen gut funktionierenden Instant-Messenger-Dienst anbieten würde. Dann könnte man vermeiden, dass sich private und universitäre Unterhaltungen in Whatsapp in die Quere kämen.
Trotz aller digitalen Angebote im Studium gibt es immer noch Situationen, in denen Studierenden Stift und Zettel lieber sind als Laptops – zum Beispiel für Mitschriften von Vorlesungen, an deren Ende eine Prüfung steht. „Wenn am Ende keine Prüfung folgt, dann nutzen viele einen Laptop, um sich Notizen zu machen“, erzählt Mario Engemann. „Ansonsten setzen die Studierenden doch lieber auf die konservative Methode und machen Notizen mit Stift und Zettel oder drucken Vorlesungsfolien aus – weil sie sich die Inhalte dann besser merken können.“