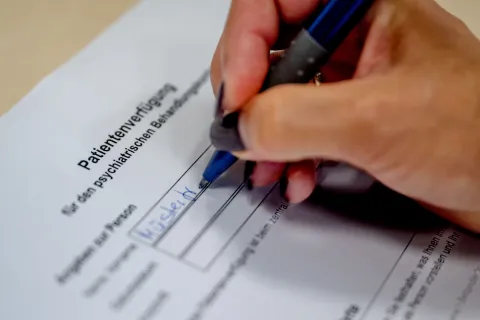Recht
Das Lieferkettengesetz jenseits der Moral
Inwieweit deutsche Unternehmen für Arbeits- und Umweltschutz am ausländischen Produktionsort mit verantwortlich sind, ist moralisch vielleicht schnell beantwortet. Juristisch betrachtet ist die Frage aber komplex.
Lange wurde in Deutschland um ein Lieferkettengesetz gerungen, das im Ausland produzierende Unternehmen dazu verpflichtet, mehr Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu übernehmen. Denn in vielen Ländern sind nicht nur Arbeits- und Herstellungskosten niedriger als hierzulande, sondern auch die sozialen und ökologischen Standards. Verheerende Arbeitsunfälle oder Umweltkatastrophen sind die Folgen.
Im Juni 2021 hat der Bundestag das Lieferkettengesetz beschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass für die Menschen in ausländischen Textilfabriken oder Minen nun alles besser wird. „Nach zähem Ringen ist wie immer ein Kompromiss herausgekommen“, weiß Prof. Dr. Matteo Fornasier, Experte für Arbeitsrecht und Internationales Privatrecht an der RUB, und ergänzt: „Ich befürchte, dass das Gesetz hauptsächlich für viel Bürokratie sorgen wird – ohne den Schutz der Menschenrechte spürbar zu verbessern.“ Unternehmen sind laut dem Gesetz zwar dazu verpflichtet, auf die Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette zu achten, und bei Verletzung dieser Pflicht kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Sanktionen verhängen. Die Unternehmen haften aber den Geschädigten gegenüber nicht.
Praktikable Haftungsregel gesucht
Die Frage, ob es eine solche Haftungsregel geben sollte und wie genau sie ausgestaltet sein sollte, ist komplex, auch weil sie diverse Rechtsbereiche an der Schnittstelle von Arbeits-, Völker- und internationalem Privatrecht berührt. Mit ihr beschäftigt sich Matteo Fornasier in seiner Forschung. Ihm geht es dabei nicht um eine moralische Bewertung, sondern um den objektiven rechtswissenschaftlichen Blick. „Ich möchte Lösungsansätze aufzeigen, wie eine praktikable Haftungsregelung aussehen könnte“, sagt er. „Denn ein Gesetz, das höchsten moralischen Ansprüchen genügt, aber dessen Durchsetzung utopisch wäre, bringt auch nichts.“


Unternehmen können sicherlich zum Menschenrechtsschutz beitragen – doch gibt es dafür Grenzen.
Matteo Fornasier
In der Diskussion um das Lieferkettengesetz prallen der im Völkerrecht verankerte Schutz von Menschenrechten und die unternehmerische Freiheit aufeinander. „Für die Wahrung der Menschenrechte sind eigentlich die Staaten verantwortlich“, erklärt Fornasier. „Unternehmen können sicherlich zum Menschenrechtsschutz beitragen – doch gibt es dafür Grenzen.“ Der Jurist gibt ein plakatives Beispiel: Wenn in China die Gründung freier Gewerkschaften nicht erlaubt ist, inwieweit ist es dann sinnvoll und realistisch, einem Autohersteller die Verantwortung für den Schutz der Gewerkschaftsrechte in chinesischen Produktionsstandorten zu übertragen?
Unternehmen haben nicht die gleiche Handhabe und nicht die gleichen Kompetenzen wie ein Staat, die Menschenrechte zu verteidigen. „Man könnte natürlich verlangen, dass sich Unternehmen aus solchen Ländern komplett zurückziehen, aber auch das kann Schaden für die lokale Bevölkerung bedeuten, wenn Arbeitsplätze verlorengehen“, verdeutlicht Fornasier.
Kaum Aussicht auf Schadenersatz
Er beschäftigte sich zunächst damit, unter welchen Umständen europäische Unternehmen nach aktueller Rechtslage für Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden durch ausländische Tochterunternehmen oder Lieferanten haften. „Geschädigte haben selten Aussicht auf Schadenersatz“, lautet sein Fazit. Wenn sie versuchen, dem lokalen Tochterunternehmen oder Zulieferer gegenüber Ansprüche gelten zu machen, haben sie es häufig mit Firmen zu tun, bei denen kein Geld zu holen ist, oder mit einem nicht funktionierenden Rechtssystem. Ansprüche gegen das europäische Hauptunternehmen scheitern oft an rechtlichen Hindernissen: Der Prozess müsste in Europa angestrengt werden, das Hauptunternehmen ist im Regelfall aber nicht verantwortlich für Sicherheitsdefizite ihrer ausländischen Tochterunternehmen oder Lieferanten.

Selten kommt es überhaupt zu Gerichtsverfahren. Und wenn – wie etwa im Fall des Brandes in einer pakistanischen Jeans-Fabrik 2012 – ist der Prozess extrem aufwändig, da die geltenden EU-Regelungen vorsehen, dass das Recht vom Unfallort anzuwenden ist. Im oben beschriebenen Fall gehörte die Fabrik dem pakistanischen Textilunternehmen Ali Enterprises, das vor allem für den deutschen Textildiscounter KiK produzierte. Angehörige von Opfern und ein Überlebender verklagten die Firma KiK 2015 vor dem Landgericht Dortmund, das nach pakistanischem Recht urteilen musste. Der Prozess zog sich knapp vier Jahre hin. Schließlich waren die Klagen verjährt.
Alle Regelungsebenen beachten
Das aktuelle EU-Recht ist auch ein Grund dafür, dass Matteo Fornasier einen nationalen Alleingang bei der Einführung einer Unternehmenshaftung skeptisch sieht. „Es könnte dazu kommen, dass man eine tolle Regelung in Deutschland hat, die gar keine Anwendung findet, weil das europäische Recht vorgibt, das Recht vom Unfallort anzuwenden“, erklärt er. Wichtig sei es daher, alle Regelungsebenen zu beachten.
Der Bochumer Jurist plädiert dafür, das Thema auf europäischer Ebene anzugehen, was auch bereits passiert. Die EU-Kommission arbeitet an einem Vorschlag für eine Verordnung; der politische Gesetzgebungsprozess könnte vielleicht schon 2022 starten. Eine europäische Lösung würde laut Fornasier zudem ein Argument vieler Unternehmen abschwächen: Die Firmen haben eine Haftungsregelung im deutschen Recht bislang unter anderem verhindert, weil sie einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu ausländischen Konkurrenten befürchten.

In dieser Diskussion gibt es nicht nur Gut und Böse, sondern auch viele Zwischentöne.
Matteo Fornasier
Matteo Fornasier vermutet auch noch einen anderen Grund: „Solche Prozesse um Haftungsfragen erzeugen viel Medienaufmerksamkeit und decken schlechte Arbeitsbedingungen im Ausland auf, die der Außendarstellung der Unternehmen schaden“, sagt er. „Zumindest denke ich, dass die Gegenwehr der Unternehmen weniger mit den Summen zu tun hat, die die Unternehmen im Schadensfall zahlen müssten. Sie sind vergleichsweise gering.“ Natürlich könne man aber nicht alle Firmen über einen Kamm scheren. „Es gibt auch Unternehmen, die sich für ein strengeres Lieferkettengesetz einsetzen“, beschreibt der Forscher und bekräftigt: „In dieser Diskussion gibt es nicht nur Gut und Böse, sondern auch viele Zwischentöne.“
Während manche Akteure aus Überzeugung für die weltweite Achtung sozialer und ökologischer Standards kämpfen, gibt es andere, die nur deswegen dafür eintreten, weil sie auf diesem Weg den Schutz von Arbeitsplätzen in Deutschland sicherstellen wollen – nicht die Einhaltung der Menschenrechte im Ausland.
Der Teufelskreis der Billigprodukte
Jenseits aller moralischen Überlegungen sieht Matteo Fornasier auch ökonomische Argumente für eine Haftungsregelung. Aktuell werden die aus Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden resultierenden Kosten auf die lokale Bevölkerung in den ausländischen Produktionsstaaten abgewälzt; sie spiegeln sich nicht in den Marktpreisen der jeweiligen Produkte wider, wodurch diese unangemessen billig werden. Durch eine Haftungsregel würden diese sozialen Kosten bei den verantwortlichen Unternehmen wirtschaftlich zu Buche schlagen und an die Verbraucher weitergereicht werden. Das könnte den Teufelskreis der Billigproduktion durchbrechen. Denn Unternehmen, die jetzt schon in Umwelt- und Sozialschutz investieren, haben aktuell einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Billigproduzenten.
[einzelbild:4]
Schritt für Schritt zur Haftungsregelung
Eine praktikable Haftungsregelung müsste laut Matteo Fornasier Schritt für Schritt entstehen. Die erste Gesetzesversion sollte nicht danach streben, jede Kleinigkeit für jedes Unternehmen zu regeln. Stattdessen sollte sie zunächst nur für große Unternehmen gelten. „Sie haben eine gewisse Macht und können vermutlich Einfluss auf ihre Lieferanten im Ausland nehmen“, so Fornasier.
Des Weiteren sollte das Gesetz erst einmal nur für Kernlieferanten gelten: bei einem Automobilhersteller etwa für die Zulieferer von Kfz-Komponenten, aber nicht für den Lieferanten, der die Personalverwaltung mit Druckerpapier versorgt. Auf letztere haben Unternehmen weniger Einfluss. Außerdem sollten im ersten Schritt die fundamentalen Menschenrechte geschützt werden, sodass menschenwürdige Arbeitsbedingungen sichergestellt sind. „Menschenrechte – das ist ein schillernder Begriff und ein weiter Begriff“, sagt Matteo Fornasier. „Er kann das Verbot von Sklaverei und Kinderarbeit ebenso umfassen wie den Zugang zu einem Ausbildungsplatz oder zu Arbeitsvermittlungsbehörden.“ Um praktikabel zu sein, sollte ein Gesetz zunächst die wichtigsten Menschenrechte in den Produktionsländern schützen. Wenn solch eine europäische Haftungsregelung einmal funktioniert, könne man sie Schritt für Schritt weiter ausbauen.