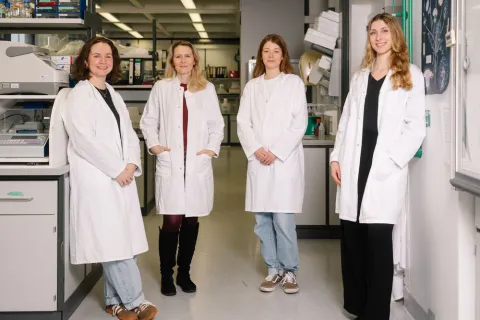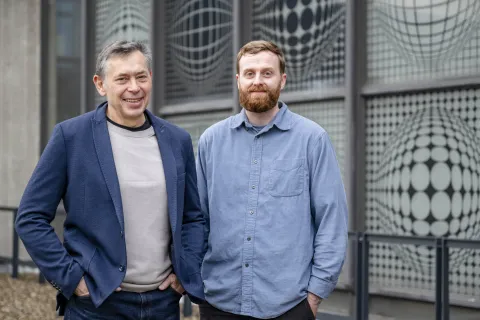Psychische Probleme bei Kindern
Man ist nicht plötzlich psychisch krank
Auffälligkeiten können sich schon im Baby- und Kleinkindalter zeigen. Karen Krause und Brunna Tuschen-Caffier erklären im Interview, wo Eltern Unterstützung bekommen und was Kinder stark macht.
Niedrigschwellige Beratungs- und Hilfsangebote bei psychischen Problemen bietet das Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit (FBZ) der RUB. Karen Krause, geschäftsführende Leiterin des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychotherapie am FBZ, erklärt: „Wir betrachten nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern beziehen auch deren Familien und das soziale Umfeld ein, um den Ursachen der Probleme auf den Grund zu gehen.“ Sehr stark geprägt wird die Arbeit am FBZ von Forschung und Herangehensweise der Direktorin Prof. Dr. Silvia Schneider. Als Überraschung zu ihrem 60. Geburtstag haben ihre Kolleginnen und Kollegen das Symposium „Kleine Leute, große Forschung“ organisiert. Die Laudatio hielt Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die Silvia Schneider schon seit Beginn ihrer Karriere kennt.
Frau Tuschen-Caffier, in welchem Alter beginnen psychische Erkrankungen?
Brunna Tuschen-Caffier: Man ist nicht plötzlich psychisch krank. Nach dem dimensionalen Modell gibt es erste Symptome, die sich erst allmählich zu einer Erkrankung ausbilden. Sie können schon im Babyalter anfangen, beispielsweise bei Schreikindern, die sich permanent unwohl fühlen und auch bei Babys, die nachts und auch tagsüber nicht schlafen können.
Auch wenn Kinder nicht essen wollen, kann das ein erstes Anzeichen sein. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob das nur auffälliges Verhalten ist oder schon eine psychische Erkrankung. Wir werden ja auch alle mit einem bestimmten Temperament geboren.
Karen Krause: Wir wissen aber aus der Forschung, dass gerade diese sehr frühen Regulationsstörungen im Säuglings- und Kleinkindalter Schrittmacher sind für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen im weiteren Verlauf.
Tuschen-Caffier: Beispielsweise bildet ein gewisser Anteil an Schreikindern oder Kindern, die hibbelig und unruhig sind, Jahre später eine Hyperaktivität aus. Deshalb ist es sehr wichtig, betroffene Familien so früh wie möglich zu beraten, wie sie ihren Alltag mit so einem Kind gestalten können. Wenn ein Baby ständig schreit und sich nicht beruhigen lässt, macht das ja auch etwas mit der Beziehung der Eltern zu ihrem Kind.
Die Situation ist für die ganze Familie sehr belastend, sodass daraus auch andere Probleme entstehen können, von einer gestörten Eltern-Kind-Beziehung bis hin zu aggressivem Verhalten gegenüber dem Kind. Da geht es dann nicht mehr nur um psychische Probleme. Wenn Eltern das Geschrei einfach nicht mehr aushalten und ihr Kind schütteln, kann es dadurch sterben. Natürlich muss auch von einem Arzt abgeklärt werden, ob bei einem Schreikind körperliche Probleme vorliegen. Kinder können auch an einer Verstopfung sterben, das muss natürlich ausgeschlossen werden.
Wo erhalten Familien mit solchen Babys Hilfe?
Tuschen-Caffier: Für sie gibt es die Baby- und Kleinkindsprechstunde am FBZ. Dort werden sie schon frühzeitig untersucht und ihre Familien beraten. Studien zeigen: Wenn man früh hilft, kann man langfristig Beeinträchtigungen und schwere Erkrankungen verhindern.
Krause: Wie genau das funktioniert, versuchen wir in unserem Baby-Lab mit der grundlagenorientierten Forschung, aber auch durch unsere klinische Forschung zu beantworten.
Tuschen-Caffier: Dieser Fokus auf die psychische Gesundheit im Kleinkindalter, aber auch auf die der größeren Kinder und Jugendlichen, ist in der Wissenschaft lange vernachlässigt worden. Silvia Schneider ist die erste gewesen, die in diesem Bereich wirklich bahnbrechende Forschung gemacht hat.
Was können Familien tun, damit ihre Kinder psychisch gesund aufwachsen?
Krause: Die gerade geschilderten Regulationsstörungen sehen wir als eine Symptomtrias, die sich ergibt aus dem Temperament des Kindes, den Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen einem Kind und seinen Eltern und Belastungsfaktoren, die die Eltern mitbringen. Es ist also bestens investierte Zeit, Zeit mit den Kindern zu verbringen, für eine gute Bindung und eine gute Beziehung zu sorgen. Das ist die Basis, auf der sich die Kinder entwickeln können.
Welches Ziel verfolgt die frühe Intervention?
Krause: Das große Konzept der Verhaltenstherapie ist: Erst mal hat Verhalten eine Funktion. Diese zu verstehen ist essenziell. Da hilft es immer, sich frühzeitig Hilfe zu holen und jemanden, der emotional nicht so eingebunden ist, mit draufgucken zu lassen. Sich einfach in einem gemeinsamen Gespräch zu öffnen und neue Ideen und Anregungen zu finden.
Besonders wichtig ist, dass Eltern dazu befähigt werden, ihren Kindern etwas zuzutrauen. Die besten Eltern sind nicht diejenigen, die ihren Kindern alles leicht machen. Gerade an herausfordernden Situationen und Schwierigkeiten passiert Entwicklung. Es gilt, diese zu unterstützen. Ziel der frühen Intervention ist es, die Eltern stark zu machen.
Wo gibt es praktische Hilfe für betroffene Familien mit Kleinkindern?
Krause: In unserer Ambulanz am FBZ bieten wir Psychotherapie und kognitive Verhaltenstherapie über die gesamte Lebensspanne an. Dabei setzen wir die aktuellen Erkenntnisse aus der Wissenschaft um, wie die von Silvia Schneider. Denn es braucht schon Hilfen im System, bevor sich eine psychische Störung manifestiert hat.
Solche niederschwelligen Hilfen gibt es im Rahmen unserer störungsspezifischen Sprechstunden. Zum Beispiel in unserer Baby- und Kleinkindsprechstunde, an die sich Familien mit Kindern bis zum fünften Lebensjahr wenden können, frühzeitig und ohne lange Wartezeit. Bei leichten Problemen benötigen wir nur wenige Beratungsstunden. Manchmal reicht es, als Bezugsperson sein eigenes Verhalten zu hinterfragen.

Ineinandergreifende Hilfen auf unterschiedlichen fachlichen Ebenen sollen psychische Gesundheit in der Familie langfristig sichern.
Karen Krause
Welche Therapieziele verfolgen Sie?
Krause: Ziel ist, die Interaktionen zwischen Eltern und Kind zu optimieren und bei Problemen schnellstens Hilfen anzubieten. Wichtig ist mir dabei: Nicht das Kind ist krank und hat das Problem, sondern es wird auf die gesamte Symptomatik geguckt – auch auf die Bezugspersonen und das soziale Umfeld. Im FBZ nutzen wir die Synergien der verschiedenen Ambulanzen. Bei hohen Belastungen wie einer psychisch kranken Mutter sorgen wir dafür, dass dieses Thema besprechbar, die Wege kurz und die Hürden geringgehalten werden, sodass die Mutter selbst Hilfe bekommt. Dann ist auch für die weitere Entwicklung des Kindes ganz viel getan.
Der Spirit, den Silvia Schneider nicht nur in die Forschung, sondern auch in die Versorgung des FBZ gebracht hat, ist folgender: Ineinandergreifende Hilfen auf unterschiedlichen fachlichen Ebenen sollen langfristig und nachhaltig eine Veränderung bewirken und so die psychische Gesundheit in der Familie sichern. Und zwar aus der Gesundheitsperspektive gedacht und nicht aus der Krankheitsperspektive.
Das ist für mich eine total inspirierende Haltung, mit der ich sehr gern in ihrem Team mitarbeite. Für die sich ergänzenden Ambulanzen, Behandlungsangebote und Forschungsprojekte, die sich immer wieder befruchten, setzen wir uns gemeinsam ein.
Welche psychischen Probleme treten bei Kindern häufig auf?
Krause: Ein großes Thema sind verschiedenste Angststörungen. Da muss man aber erst mal gut hingucken und herausfinden, wovor genau das Kind Angst hat. Bei Trennungsangst ist es ja typisch, dass Kinder Angst haben, sich nicht in der Nähe der Eltern aufzuhalten.
Wenn ein Kind beispielsweise Bauchschmerzen und Angst hat, wenn es zur Schule muss, ist das möglicherweise ja gar nicht die Angst, dass die Mutter oder eine andere Bezugsperson das Kind alleine lässt und ihr etwas zustößt, sondern einfach nur die Angst vor der Schule. Vielleicht ist das Kind den Aufgaben dort nicht gewachsen und möchte deshalb lieber zu Hause bleiben, oder es wird ausgelacht und hat deshalb Angst, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Wie verhält sich ein Kindergartenkind mit Trennungsangst und wie reagieren die Eltern?
Krause: Bei Trennungsangst ist sehr typisch, dass eine Mutter ein Kind, das nicht in den Kindergarten will und jeden Tag beim Hinbringen weint, wieder mit nach Hause nimmt und sich dort einen schönen Tag mit ihm macht. Ebenso bei einem Schulkind, das zu einer Party eingeladen ist und nicht hinmöchte. Da merkt man dann schon, dass das Verhalten der Mutter das Verhalten des Kindes formt. Als Eltern möchte man sein Kind natürlich schützen und hält es nicht gut aus, wenn es so schlimm weint. Dann macht man etwas, was kurzfristig dem Kind hilft, langfristig aber schadet.

Wenn man immer zu Hause bleibt, um die angstauslösenden Situationen zu vermeiden, nimmt man seinem Kind Entwicklungschancen.
Brunna Tuschen-Caffier
Was ist bei einer Angststörung das Therapieziel?
Krause: Ziel der Expositionstherapie ist, dass das Kind Selbstwirksamkeit lernt, nach dem Motto: „Ich weiß, es ist schwierig, wenn ich mich meiner Angst stelle, aber ich bin gut vorbereitet und kann und will das schaffen.“ Ich schubse das Kind nicht einfach in die angstauslösenden Situationen rein. In der Therapie steckt eine Menge gute psychoedukative Vorarbeit mit dem Kind, für die wir uns viel Zeit nehmen. So merkt das Kind, dass es die Angst bewältigen kann.
Tuschen-Caffier: Wir beziehen natürlich auch die Eltern mit ein. Ihnen erklären wir, wie Angst entsteht und dass man sie auch wieder verlernen kann. Wir machen dann zum Beispiel ein Gedankenexperiment mit ihnen, das sehr gut funktioniert: „Stellen Sie sich vor, es geht jetzt noch ein paar Jahre so weiter. Wenn man immer zu Hause bleibt, um die angstauslösenden Situationen zu vermeiden, nimmt man seinem Kind Entwicklungschancen. Es braucht andere Kinder, um wichtige Fertigkeiten zu lernen. Es muss ja auch in die Schule gehen können.“
Wir sehen uns genau an, wo das Kind steht, welche Unterstützung es noch braucht und führen es nach und nach an die angstauslösenden Situationen heran. Dann sollte das Kind allmählich lernen: „Ich kann das auch allein, ich brauche die Mama dazu gar nicht. Aber das heißt ja nicht, dass die Mama mir weggenommen wird, wenn ich jetzt so stark bin. Ich kann dann etwas anderes Schönes mit ihr machen.“ Das ist für beide ganz wichtig.
Was sind Alarmzeichen für eine psychische Störung?
Krause: Erst mal ist es wichtig zu verstehen, dass Angst etwas total Normales ist, das uns hilft, wach und aufmerksam zu sein. Sie hat also die Funktion, uns an verschiedene Situationen anzupassen. Wenn ich aber zum Beispiel als Mutter merke, dass die Angst, die mein Kind erlebt, viel größer ist als bei altersgleichen Kindern, sodass es in seiner Peer-Group im Kindergarten oder in der Schule immer außen vor bleibt oder Dinge nicht mehr tun kann, die sie oder er eigentlich tun möchte, dann sollte ich mir ganz dringend Hilfe holen.
Daran erkenne ich ein Maß an Angst, das beeinträchtigt und Leidensdruck verursacht. Diese zwei Kriterien sehe ich mir als Diagnostikerin an und finde genauer heraus, welche inhaltliche Ebene besteht. Denn von Trennungsangst betroffene Kinder vermeiden die Situationen, die ihnen Angst machen und die Eltern vermeiden mit. Weil in ihrem Kopf die Idee besteht: „Mein Kind ist halt so. Also lassen wir das.“ So haben sie dann keinen Leidensdruck mehr, über den sie reden müssten. Die klinische Forschung zeigt aber, dass eine Angst selten allein kommt. Deshalb reicht es nicht, mich auf die eine Angst zu fokussieren, die benannt wird. Wenn ich da als Therapeut nicht genau hinschaue, besteht die Gefahr, etwas zu übersehen.

Es ist ein sehr komplexer Ansatz, der den Menschen mit seiner sozialen Umwelt in den Mittelpunkt rückt.
Brunna Tuschen-Caffier
Wie finden Sie die Gründe für die Angst heraus?
Krause: Durch das systematische Abfragen aller Bereiche, in denen psychische Erkrankungen auftreten können. Gleichzeitig signalisiert man der Familie damit, dass man sich Zeit für sie nimmt. Dieses Verfahren hat Frau Schneider in ihrem Leitfaden „Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter“, kurz DIPS exzellent standardisiert. Er ermöglicht, dass verschiedene Therapeuten bei einem Kind verlässlich auf dasselbe diagnostische Ergebnis kommen und somit eine Therapie durchführen können, die auch zur Lebensrealität und zur Symptomatik des Kindes passt.
Ist dieser Leitfaden für alle Psychotherapeuten zugänglich?
Krause: Ja, neue Methoden und Diagnostikinstrumente über Open Access kostenfrei der Allgemeinheit zugänglich zu machen ist auch eine große Ambition von Silvia Schneider. So möchte sie Forschungsergebnisse nachhaltig und schnell in die Therapie integrieren.
Inwiefern hat Frau Schneider die Sichtweise auf psychische Erkrankungen verändert?
Tuschen-Caffier: Das Besondere an Frau Schneider ist, dass sie sich nicht wie die meisten anderen Psychotherapeuten auf einen Teilbereich der Psychologie spezialisiert hat, sondern die Idee verfolgt: Wir brauchen Grundlagenwissen, diagnostisches und therapeutisches Wissen, und wir müssen nicht nur das Kind, sondern auch die Familie und die Gesellschaft im Blick behalten.
Wichtig ist auch, dass Menschen mit Angststörungen im Alltag normalerweise weitere Probleme haben. Je länger eine Angsterkrankung besteht, desto wahrscheinlicher wird es, dass man eine Depression entwickelt, weil man aus Angst sein Leben nicht mehr bewältigen kann. Dann steht gegebenenfalls die Depression im Vordergrund, und gerade im Jugendalter muss man herausfinden, ob vielleicht auch Suizidgedanken da sind. Es ist also ein sehr komplexer Ansatz, der den Menschen mit seiner sozialen Umwelt in den Mittelpunkt rückt. Diese Sichtweise ist leider noch nicht selbstverständlich.