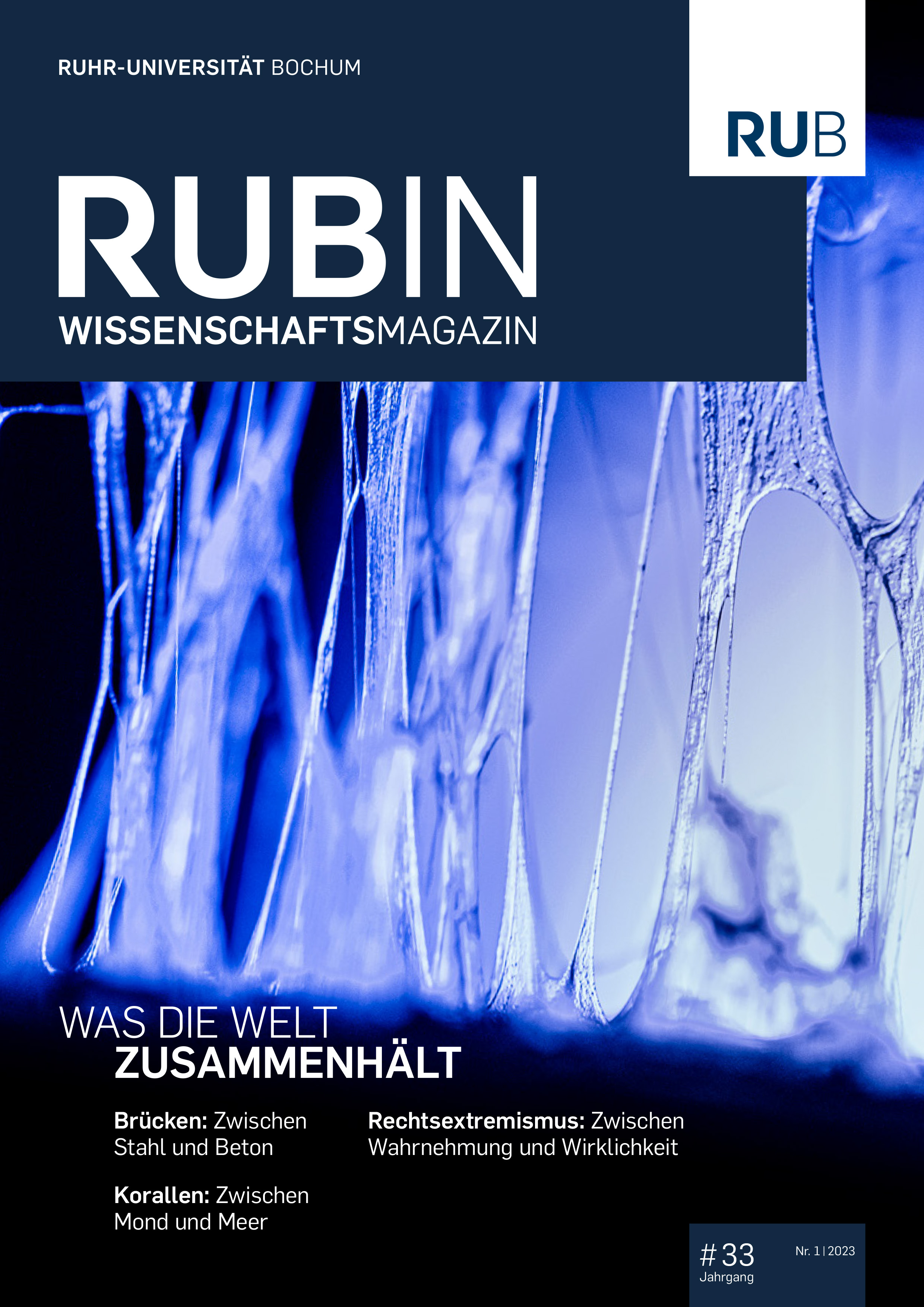Im Gespräch
Vernetztes Schreiben
Über die politische Rolle von Fiktion, eine neue Öffentlichkeit und die Widerstandskraft der amerikanischen Demokratie spricht Amerikanistin Laura Bieger im Interview.
Das Politische findet unweigerlich seinen Weg in das Werk von Kunst-, Kultur-, und Literaturschaffenden. Doch wie politisch darf und soll Fiktion eigentlich sein? Diese Frage treibt Prof. Dr. Laura Bieger seit Jahren um. Die Amerikanistin blickt besorgt auf ein politisch zerrissenes Land und beobachtet einen deutlichen Politisierungsruck in der amerikanischen Gesellschaft, der sich in Kultur und Medien, aber auch in der kritischen Reflektion dieser Texte widerspiegelt. Besonders bemerkenswert findet Bieger das Phänomen, dass mehr und mehr Autorinnen und Autoren sich bewusst dazu entscheiden, mit unterschiedlichen Textformen und Plattformen zu experimentieren, sich stärker medial vernetzen, um Politisches auszuhandeln, zu reflektieren und zu diskutieren.
Frau Professorin Bieger, was bedeutet Zusammenhalt für Sie?
Zusammenhalt hat elementar mit sozialen Beziehungen zu tun. Soziale Beziehungen werden vermittelt durch unsere Kultur, unsere Erinnerungskultur, unsere gemeinsamen Rituale. Durch kulturelle Praktiken und Kommunikationsformen verständigen und einigen wir uns auf Werte, würdigen sie, machen sie publik. Auf diese Weise wird auch Zusammenhalt hergestellt und vermittelt.
Als Amerikanistin erforschen Sie die Kultur, Gesellschaft und Literatur in den USA. Sie waren erst kürzlich an der Harvard University zu einem Forschungsaufenthalt. Wie haben Sie die USA, den Zusammenhalt in den USA erlebt?
Als unglaublich zerrissen und polarisiert. Das ist natürlich nichts Neues oder Überraschendes. Wir haben es zuletzt bei der Wahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gesehen: den traurigen Zustand der Republikanischen Partei und den der amerikanischen Demokratie.

Nachrichten über Massenschießereien in High Schools und Supermärkten sind integraler Bestandteil der US-amerikanischen Kultur geworden und gehören mittlerweile in den USA zum Alltag. Viele davon sind offenkundig und bekennend rassistisch. Solche Ereignisse fordern einen als Wissenschaftlerin, die sich mit dem Land, dieser Kultur befasst, heraus, aber treffen einen auch persönlich ins Mark – insbesondere, wenn man sich gerade vor Ort aufhält oder mit Freunden und Bekannten vor Ort spricht.

Das strapaziert den Zusammenhalt
Laura Bieger
Erst kürzlich war ich in einem Call mit einer amerikanischen Kollegin aus Santa Cruz, die sich um ihr Kind sorgte, weil an der Schule vor einem möglichen Anschlag gewarnt wurde. Das gehört dort mittlerweile und traurigerweise zum Alltag dazu: Mütter müssen hoffen, dass ihre Kinder heil durch die Schulzeit kommen. Die Kollegin war genervt, dass diese Sorgen, die Beschäftigung damit so viel Raum und Zeit in ihrem Leben einnehmen. So etwas strapaziert den Zusammenhalt. Auf der anderen Seite finde ich es sehr bemerkenswert, was für eine große Widerstandskraft es im Land gibt und mit welchem Pragmatismus sie dort den Herausforderungen begegnen.
Wie reagieren Autor*innen und Kulturschaffende auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Lande?
Ich beobachte sowohl in der Literatur, in den Künsten als auch in der kritischen Auseinandersetzung damit, einen deutlichen Politisierungsruck. Auch ich habe am Tag nach der Trump-Wahl gedacht: Ich möchte, dass sich meine Forschung stärker auf explizit politische Fragen ausrichtet. In der zeitgenössischen Literatur- und Kulturproduktion hat es auch diesen politischen Ruck gegeben. Ein guter Moment also, um die Frage nach einer politisch engagierten Kunst und Literatur zu stellen – die traditionell keinen guten Ruf genießt.
Warum nicht?
Es gibt immer wieder Diskussionen um die Autonomie von Kunst. Einige sind der Ansicht, dass Kunst radikal autonom sein muss, um überhaupt gute Kunst zu sein. Das heißt auch, dass Kunst, die sich gezielt in einem politischen Sinne engagiert, keine gute Kunst sein kann. Auf der anderen Seite haben Kunst, Printmedien oder auch Literatur eine besondere Fähigkeit, soziale Aushandlungsprozesse zu inszenieren und durchzuspielen, eine Art Trainingsplatz oder Testumgebung für politische Prozesse zu schaffen. Hier werden beispielsweise Werte sozial ausgehandelt. Manche Kunstformen oder Genres, etwa Politisches Theater oder der Essay, scheinen dabei mehr soziales Gewicht und Prestige zu haben als andere. Ich finde, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um sich die Diskussionen und auch Dichotomien näher anzuschauen, sich mit politisch engagierter Kunst, Literatur und der Rolle von Öffentlichkeit zu beschäftigen.
Was haben Sie auf den fiktionalen Trainingsplätzen beobachtet?
Was ich beobachte und höchst interessant finde, ist, dass es ein gezieltes Vernetzen der eigenen Arbeiten gibt. Viele der zeitgenössischen Autorinnen und Autoren werden politisch, ergänzen ihre Fiktion durch journalistisches und essayistisches Schreiben. Sie nutzen Plattformen wie etwa Twitter, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, probieren andere Erzählmedien wie Podcasts oder Filme aus. Dieses bewusste mediale Vernetzen ist, meiner Meinung nach, ein ganz bemerkenswertes Phänomen.
Was fasziniert Sie daran?
Mich interessiert, wie dieses Beziehungsgeflecht an Texten am politischen Geschehen teilhat. Dabei spielt das künstlerische Werk im engeren Sinne eine zentrale Rolle, aber die größeren Beziehungen, in die es eingelassen ist, eben auch. Was tragen diese unterschiedlichen Medieninhalte etwa zur Spaltung oder zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei? Und was brauchen wir für theoretische Werkzeuge, welchen Begriff von Ästhetik zum Beispiel, um das Beziehungsnetz an Texten konzipieren zu können? Diese Fragen treiben mich gerade um.
Sie haben sich zuletzt eingängig mit dem Roman „Native Son“ des Schriftstellers Richard Wright auseinandergesetzt. Wie politisch ist Wrights Schreiben?
Wrights Roman „Native Son“ ist 1940 erschienen und hat damals dazu geführt, dass ein Ruck durch die amerikanische Literaturproduktion und Gesellschaft ging. Der Roman bekam eine große Öffentlichkeit, regte Debatten an, wurde unglaublich kontrovers diskutiert.

Was war so ungewöhnlich an dem Roman?
Vor diesem Roman wäre es undenkbar gewesen, einen Protagonisten zu schaffen, der Schwarz, ein Vergewaltiger und Serienmörder ist. Der Autor ist mit seiner realistischen Darstellungsweise von „Bigger“ – so heißt der Protagonist – ein großes Risiko eingegangen.
Was hat Sie an dem Roman interessiert?
Was mich vor allem interessiert hat, ist, dass der Roman so provokativ war, dass er mehrere Akte der Autorisierung von seinem Autor einforderte. Wright hat sich zunächst in einem separaten Pamphlet zu seinem Protagonisten geäußert, daraus wurde dann ein Nachwort, inzwischen ist es die Einleitung des Romans. In diesem Pamphlet, das „How Bigger was born“ heißt, erklärt Wright, dass der fiktive Protagonist seines Romans eine Zusammensetzung von unterschiedlichen Personen ist, die er, der Autor, in seinem Leben kennt. Es gibt also eine Rückkopplung an die persönliche Erfahrung des Autors, seine gelebte Realität. Das Genre und der Protagonist haben Wright in die Pflicht genommen, die Fiktion zu erklären, erst im Essay, und später in seiner Autobiografie, die ein Bestseller wurde.
Der Roman und sein kontroverser Protagonist werden auf diese Weise zu Akteuren in einem komplexen Gefüge von Beziehungen, innerhalb dessen sowohl der künstlerische Wert des Romans als auch seine politische Wirkung ausgehandelt werden. Und zwar von der lesenden Öffentlichkeit, also von Kritikerinnen und Kritikern, von Leserinnen und Lesern und Verlagen.
Was bedeutet das für die Rolle und den Einfluss von Fiktion?
Der Roman „Native Son“ zeigt, dass diese politisch engagierte Literatur noch mal ganz andere Kräfte entwickeln kann, wenn sie diese unterschiedlichen Schreibformate, das fiktionale, essayistische und autobiografische verbindet. Was man hier sehen kann, ist eine Vernetzung des Schreibens. Wright ist, meines Wissens, der erste Autor in der amerikanischen Literatur, der diese Art der Vermischung, des Hin und Her zwischen verschieden Schreibformen, fiktionalen und autobiografischen, kultiviert hat.
In Ihrem Buch zu „Belonging and Narratives“ vertreten Sie die These, dass mit Romanen Gefühle von Heimat und Zugehörigkeit vermittelt werden können. Romane seien „primary place and home making agents“. Wie wichtig sind Romane und mediale Netze für die Schaffung eines Zusammenhaltgefühls?
Kulturelle Darstellungen finden immer in sozialen Kontexten statt. Der Gebrauch von Gesellschaft-stiftenden Medien hält uns zusammen. Damit meine ich sowohl die Inhalte dieser Medien als auch die Netze von Beziehungen, die dahinterstehen.
Wie kann es gelingen, mithilfe der medialen Netze aktuell Brücken zu schlagen?
Zurzeit schaffen diese Medien in den USA separate Realitäten. Kommunikation findet in eigenen Blasen statt, in denen eigene Werte und Regeln gelten. Das ist das offensichtliche Problem. Wie schafft man Medien, die wieder Brücken schlagen, die Polarisierung aufbrechen? Wie schafft man andere Bündnisse? Welche Kommunikationsformen sind sinnvoll, um die Verhärtungen der Lager aufzubrechen? Und macht das Sinn? Viele sind derzeit der Meinung, dass es pure Zeitverschwendung sei, mit Trumpisten oder Evangelikalen zu reden.
Wagen Sie eine Prognose für die Zukunft der USA?
Seit ein paar Jahrzehnten verhärtet sich die politische und gesellschaftliche Situation im Land, wird sie schlechter anstatt besser. Da ist es schwierig, eine optimistische Prognose zu wagen, vor allem, wenn es die nahe Zukunft betrifft.
Vor 250 Jahren war die US-Demokratie eine abgefahrene Sache und auch dann schon mit wesentlichen Fehlern behaftet, heute gibt es einen fundamentalen Modernisierungsbedarf, der mit dem Zweiparteiensystem anfängt, das sich da rausgebildet hat und der fortwährenden Notwendigkeit, sich mit dem Erbe der Sklaverei auseinanderzusetzen. Meine Hoffnung gründet auf einem Glauben an die Resilienz der amerikanischen Demokratie und ihre Fähigkeit, sich selbst zu reformieren. Aber ich mache mir auch ernsthafte Sorgen.
Zusammenhalt in den USA geht nicht ohne …?
… eine andere Gesprächskultur und ohne die Anstrengungen und Bemühungen, diese Gesprächskultur herzustellen.