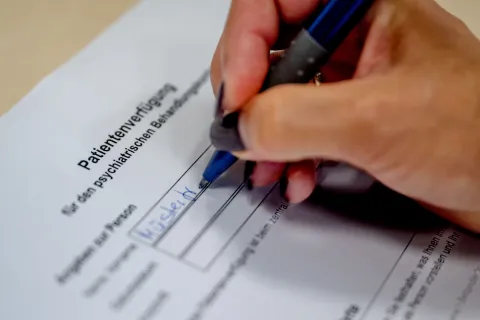Sozialwissenschaft
Wenn die Grenze mitwandert
Auf welche internen Grenzen Flüchtlinge, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in Europa stoßen, sobald sie die territoriale Grenze passiert haben, zeigt eine Untersuchung in der Main-Metropole Frankfurt.
Die Skyline von Frankfurt am Main hebt sich schon von Weitem sichtbar vom Himmel ab. 700.000 Menschen unterschiedlicher Herkunft leben in der Metropole. Frankfurt zählt damit nicht nur zu den fünf größten deutschen Städten, sondern erfüllt auch als einzige Stadt Deutschlands aufgrund ihrer Vernetzung, insbesondere der Finanzkapitalströme, die Kriterien einer sogenannten Global City. „Global Cities zeichnen sich durch ihre Größe, Heterogenität und Dichte an Migrant*innen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen aus“, erklärt Prof. Dr. Margit Fauser von der Ruhr-Universität Bochum. Das Verständnis von Städten als Integrationsraum bewog die Soziologin dazu, im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt „Die Entstehung urbaner Grenzräume in Europa“ die Global City Frankfurt näher unter die Lupe zu nehmen. Mit welchen Grenzen sehen sich EU-Bürger*innen und Flüchtlinge dort konfrontiert? Dazu führte Fauser Interviews mit Vertreter*innen aus Behörden und Wohlfahrtsorganisationen. Ihr Ergebnis offenbart, wie komplex die Grenzerfahrung von Migrant*innen ist und macht deutlich, dass es an der Zeit ist, den Begriff der Grenze neu zu definieren.

„Städte werden in der Migrationsforschung als Integrationsräume und -motoren wahrgenommen“, erklärt Fauser. „Sie gelten häufig als progressiver und aktiver, weil sie näher an den Problemen dran sind. Sie müssen unmittelbar Lösungen finden, sind für die Inklusion zuständig, aber verhandeln eben auch Exklusionen“, so die Soziologin. Kurz: Was in Städten passiere, sei längst keine rein städtische Angelegenheit mehr. Städtische Akteure würden auch über die Grenzen ihrer Stadt und manchmal auch des Nationalstaates hinaus wirken. „Darum betrachte ich Städte gern als Zugang und Eintrittsperspektive.“
Im Dschungel der Global City
Für ihre Studie hat sich Fauser auf die einzige Global City Deutschlands fokussiert: Frankfurt am Main. „Als Stadt mit dem größten Anteil nicht-deutscher Staatsangehöriger, zählt Frankfurt zu den diversesten Städten Deutschlands“, weiß Fauser. Die Stadt sei zudem bekannt für ihre lange Geschichte der multikulturellen Stadtpolitik. Kommt man als EU-Bürger*in oder Flüchtling nach Frankfurt, sehe man sich dennoch einem wahren Dschungel an Aufenthaltsstatus-relevanten Institutionen gegenüber. „Es gibt ein breites Spektrum an neuen Akteur*innen aus dem städtischen Raum, die die internationale Grenze mit verhandeln“, berichtet Fauser.
40 Behörden und Wohlfahrtsorganisationen befragt
Für die Studie haben die Forscherin und ihr Team mit Vertreter*innen von 40 institutionellen Behörden, Vereinen, Wohlfahrtsorganisationen und NGOs aus den Bereichen Gesundheit, Arbeit und Familie gesprochen. Darunter waren die Ausländerbehörde, das Jobcenter, das Sozialamt, das Gesundheitsamt, das Jugendamt, die Caritas, die Diakonie und diverse Vereine. „Wir haben narrative Interviews geführt, also viele offene Fragen gestellt. In der qualitativen Sozialforschung nennt man den Ansatz Grounded Theory“, erklärt Fauser. Die Mitarbeitenden sollten von ihrer Arbeit berichten und von Fällen erzählen: Wie läuft ein typisches Beratungsgespräch ab? Wie sieht ein gelungener Vermittlungsprozess aus? Was sind wiederkehrende Hürden?
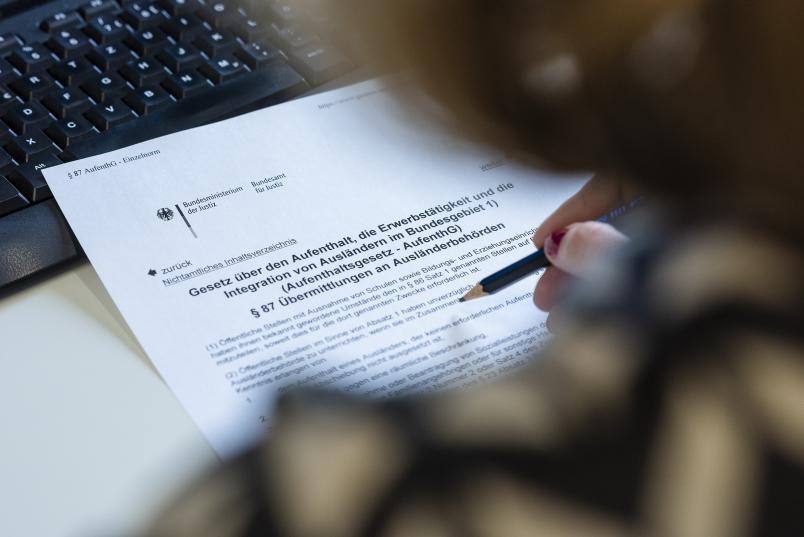
Ihre Antworten? „Die Städte werden zwar von allen als Integrationsräume wahrgenommen. Dennoch berichten die Befragten ebenfalls von Exklusionen und einer starken Fragmentierung, die viel zu wenig in Rechnung gestellt wird“, fasst Fauser zusammen. „Ein Aufenthaltsstatus allein gewährleistet nicht automatisch ein geordnetes Arbeitsverhältnis, den Zugang zur Gesundheitsversorgung oder den Anspruch auf Familienzusammenführung“, so Fauser.

Aus einer Aufenthaltskategorie lässt sich nicht automatisch ein Inklusionspfad ableiten.
Margit Fauser
Es gebe auch keine lineare aufenthaltsrechtliche Hierarchie. „Aus einer Aufenthaltskategorie lässt sich nicht automatisch ein Inklusionspfad ableiten“, erklärt die Soziologin. Unterschiedliche Gruppen würden unterschiedlich behandelt. „Es wurde berichtet, dass Zuwander*innen aus Osteuropa und Südosteuropa sich zum Teil größeren Hürden gegenübersahen, keinen Zugang zu Unterstützung hatten und manchmal auch mehr Diskriminierung erfuhren als etwa Flüchtlinge aus Syrien.“ In den Interviews sei auch immer wieder deutlich geworden, dass nicht nur der formale Aufenthaltsstatus eine Rolle spiele, sondern auch andere Kategorien wie Geschlecht, Gesundheitszustand, Religion, Herkunftsland oder Bildungsstatus bei der Jobvermittlung mitverhandelt wurden. „Es geht also um zusätzliche symbolische Hierarchien“, resümiert Fauser.
Komplexe und dynamische Grenzen
Insgesamt hätten die Interviews ihr die Komplexität und Dynamik der Grenze vor Augen geführt. „Die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Familie greifen stark ineinander. Wenn ich beispielsweise als Zuwanderin aus der EU kein reguläres Beschäftigungsverhältnis habe, dann habe ich in der Regel auch keine Krankenversicherung und kann auch meine Familie nicht nachholen.“ Je nach Status gebe es ganz unterschiedliche Hürden. „Ich kann als anerkannter Flüchtling zum Beispiel in einem Feld inkludiert und integriert sein, aber in einem anderen exkludiert.“ Fauser spricht auch von differenzieller oder partieller Inklusion.
Über 80 Aufenthaltskategorien
Eine Wurzel des Problems sieht die Wissenschaftlerin in der Vielzahl von Aufenthaltskategorien. „In Deutschland gibt es über 80 verschiedene Abstufungen und Kategorien, die den Zugang zu Arbeit, zu Sozialleistungen oder die Aufenthaltsperspektive regeln. Diese werden ständig reformiert, es gibt unzählige Ausnahmen und einen großen Ermessungsspielraum.

Das Ergebnis von einzelnen Entscheidungen ist kaum vorhersagbar.
Margit Fauser
Die Fälle sind uneindeutig, sodass das Ergebnis von einzelnen Entscheidungen kaum vorhersagbar ist“, berichtet Fauser. So würden in einigen Fällen Integrationsbemühungen – der Erwerb der Sprache, ehrenamtliche Tätigkeiten – prämiert; in anderen nicht. Manchmal gelingt es Beratungsstellen, Personen in Krankenkassenverhältnisse zu bringen und manchmal nicht.
Von Brokern und Gatekeepern
Ferner hat Fauser beobachtet, dass die Mitarbeitenden der Behörden und Organisationen selbst aktiv an den Grenzverhandlungen teilhaben. „Sie werden in die Grenzsituation mit reingezogen. Und das ist ja nicht ihre Aufgabe“, so Fauser. Die Forscherin hat verschiedene Rollen identifiziert, die die Mitarbeitenden einnehmen. „Da gibt es zum Beispiel die Broker, die versuchen, die Rechte der Migrant*innen im Rahmen der existierenden Praktiken und Regeln durchzusetzen, oder die Advokaten, die sich energisch für die Migrant*innen und deren Rechte und gegen Diskriminierung einsetzen. Es gibt aber auch solche, die sofort und direkt humanitäre Hilfe leisten und dabei bisweilen die Migrant*innen ins Regelsystem bringen wollen. Und es gibt die Gatekeeper, die informell tätig werden, sich privat und ehrenamtlich engagieren“, erklärt die Soziologin.
Den Grenzbegriff neu denken
Was bedeuten diese Beobachtungen für den Grenzbegriff? „Unsere Studie hat verdeutlicht, dass sich das europäische Grenzregime stark verändert hat und man heute vom bordering, von der Grenze als Praktik, sprechen muss, an der unterschiedliche Personen beteiligt sind“, resümiert Fauser. Das Grenzverständnis ende nicht an der territorialen Grenzlinie. Fauser plädiert daher dafür, den Grenzbegriff neu zu denken. „Die Grenzen selbst sind in Bewegung geraten. Die Grenze wandert mit den Menschen mit und wird sie begleiten. Wir beobachten neue Grenzmomente, neue Orte, und neue Akteur*innen, die die Grenzen verhandeln.“

In vielen Bereichen wäre es ein Gewinn, Entscheidungen weniger an rechtlichen Kategorien festzumachen.
Margit Fauser
Welche Folge hat das konkret für die Integration im städtischen Raum? „In vielen Bereichen wäre es ein Gewinn, Entscheidungen weniger an rechtlichen Kategorien festzumachen“, findet Fauser. Die Stadt Frankfurt böte bereits eine humanitäre Gesundheitsversorgung unabhängig vom Aufenthaltsstatus an. „Solche Maßnahmen verbessern die Lebensbedingungen vieler Migrant*innen unmittelbar.“