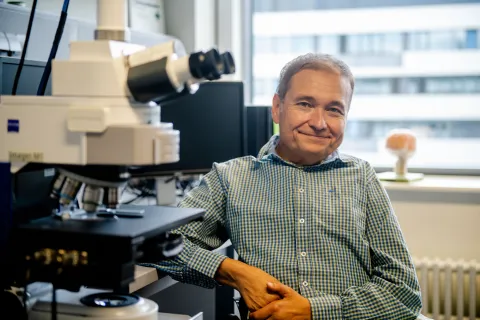Neurowissenschaft
Franziska Labrenz erforscht die Kommunikation der Darm-Hirn-Achse
Sie ist Teil des Extinktions-Netzwerks und hat bereits Stationen an allen drei Standorten der Universitätsallianz Ruhr absolviert. Franziska Labrenz erforscht die vielfältigen Einflussfaktoren unseres Schmerzempfindens.
Was fasziniert Sie an der kognitiven Neurowissenschaft?
Dass es jede und jeden von uns etwas angeht: Jeder Mensch denkt, träumt und erinnert sich, handelt oder fühlt aus bestimmten Motivationen heraus – das gilt ja im Grunde auch schon im Tierreich. Beim Menschen finde ich besonders faszinierend, dass ganz kleine Neuronen sich zu Netzwerken zusammenfügen und uns bestimmen. Das zeigt sich vor allem im Schmerzbereich. In der Abteilung für Medizinische Psychologie sehen wir täglich, wie chronisch viszerale Schmerzen, beispielsweise Bauchschmerzen, die Welt der Patientinnen und Patienten komplett verändern und unser Leben beeinflussen können. Schmerzen werden auf der ganzen Gefühlspalette völlig unterschiedlich assoziiert, und das ist für die Betroffenen oft besonders schlimm – also gar nicht der Schmerz an sich, sondern vielmehr das, was damit einhergeht.

Der Darm ist das zweite Gehirn des Menschen.
Ich forsche speziell zur Darm-Hirn-Achse: Das Gehirn und der Darm sind eng miteinander verknüpft, mittlerweile sagen sogar viele: Der Darm ist das zweite Gehirn des Menschen. Diesen Ansatz verfolge ich auch. Die aufsteigenden Verbindungen vom Darm zum Gehirn steuern eigentlich viel mehr unsere Emotionen, unser Verhalten und Gedächtnis als die absteigenden Bahnen vom Gehirn zum Darm und können vielfältige Fehlfunktionen hervorrufen.
Welches ist das wichtigste Forschungsergebnis Ihrer bisherigen Arbeit?
Das ist bei uns besonders schwierig und sehr komplex, insbesondere wegen des bio-pyscho-sozialen Krankheitsmodells. Wir haben den Darm und das Gehirn, also biologische Faktoren, aber auch viele andere Komponenten, die mit hineinspielen – psychologische oder soziale Faktoren, etwa das individuelle Schmerzempfinden und wie man emotional und kognitiv mit Schmerzen umgeht oder das persönliche Umfeld in der Familie und auf der Arbeit. In dieser Komplexität gibt es nicht das eine bahnbrechende Ergebnis. Spannend ist jedes Ergebnis, weil es sich wie ein Puzzlestück in das große Ganze einfügt und neue Ansätze für Forschungsfragen hervorbringt.

Wir können den Patientinnen und Patienten heute wesentlich besser helfen als vor 30 Jahren.
Es gibt von älteren Kolleginnen und Kollegen in unserem Fach eine Polemik, in der es heißt: 30 Jahre Forschung und wir sind keinen Schritt weiter. Da herrscht teilweise Frustration, da die Ursachen und Entstehung chronisch viszeraler Schmerzen noch nicht hinreichend geklärt sind und die Diagnostik und Therapie stark von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten abhängen. Ich sehe aber zum Beispiel auch die Fortschritte und finde, wir können den Patientinnen und Patienten heute wesentlich besser helfen als vor 30 Jahren.
Konkret untersuchen wir hauptsächlich Lern- und Gedächtnisprozesse, indem wir Schmerzen im Darm simulieren und den Patienten bestimmte Symbole zeigen, sodass beides miteinander assoziiert wird. Das ist das Grundmodell der klassischen Konditionierung. Mein persönlicher Traum wäre eines Tages ein Medikament oder eine einfache Therapie, die diese Assoziation löst, sodass die Patienten dann auf jeden Fall wieder besser leben können.
Sie engagieren sich besonders in der Gleichstellung. Was macht für Sie gute, gelingende Gleichstellung aus?
Ich persönlich tue mich mit dem Begriff Gleichstellung generell schwer – das klingt immer ein bisschen danach, dass bestimmte Quoten erfüllt werden müssen und irgendwer am Ende vergessen wird und zu kurz kommt. Im Gleichstellungsrat des Sonderforschungsbereichs 1280 „Extinktionslernen“ gehen wir eher den Weg über die individuellen Kompetenzen und Interessen, fragen und schauen: Was kann jemand? Wir lassen die jungen Forscherinnen und Forscher für sich selbst ausloten, was ihnen besser liegt: Manche sind besonders gut in der Lehre, andere forschen gern im Team und wieder andere können besser im stillen Kämmerlein für sich an ihren Daten arbeiten und konzentriert an einem Paper schreiben. Wir verstehen unter Gleichstellung, aus jedem und jeder das Maximum herauszuholen und dabei auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass jemand auch mal für eine begrenzte Zeit weniger in der Lehre eingebunden wird, wenn eine Publikation fertiggestellt werden muss, dass es Möglichkeiten zur flexiblen Arbeit gibt, zum Beispiel Homeoffice, oder Angebote zur Kinderbetreuung.