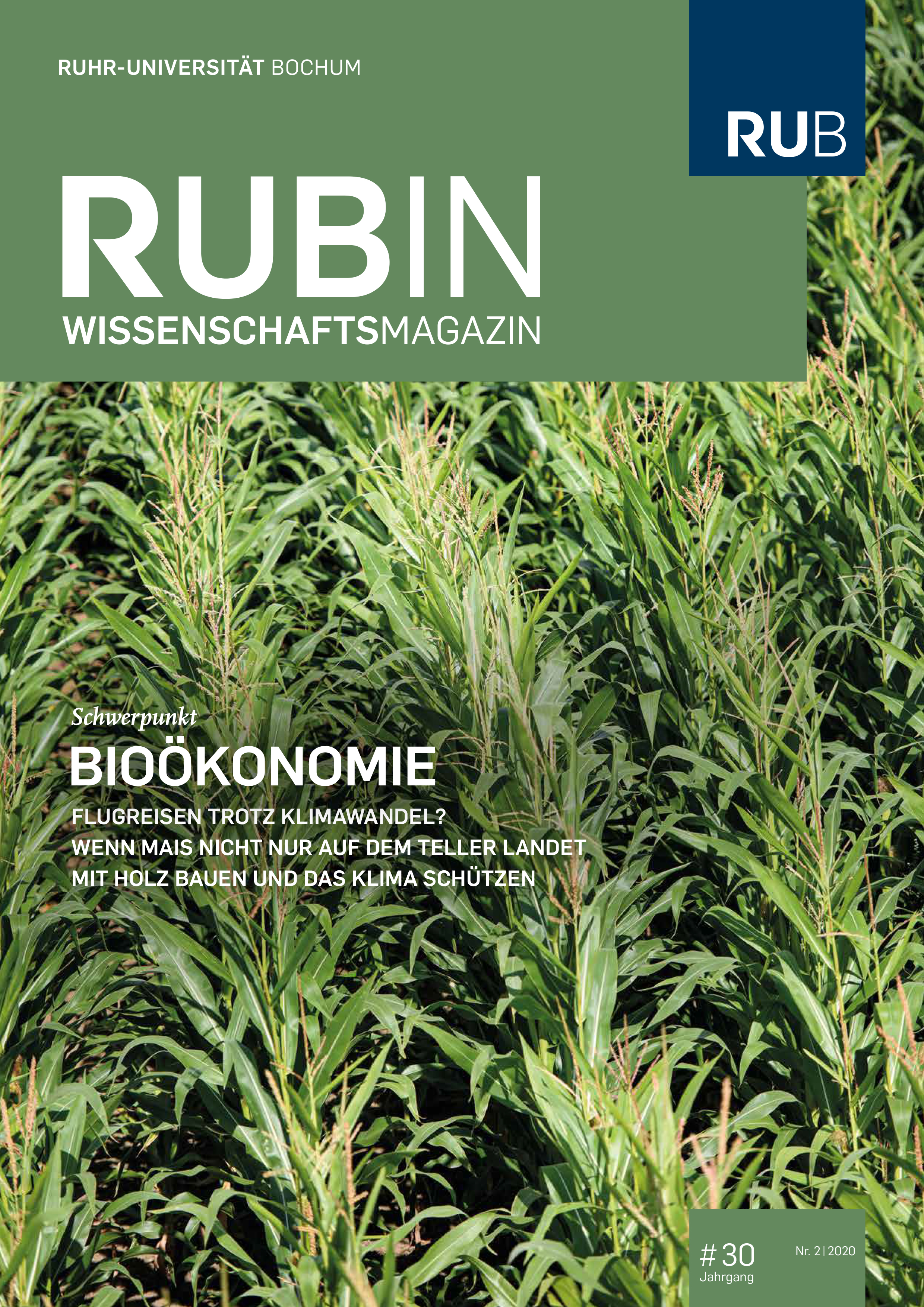Bauwesen
Mit Holz bauen für den Klimaschutz
Plastikverbot, Energiewende, neue Verkehrskonzepte – die Politik dreht an vielen Stellschrauben, um das Klima zu schützen. Beim Wohnungsbau wäre noch Potenzial.
Wenn von einem Holzhaus die Rede ist, kommen vielen Menschen zunächst Fachwerkhäuser oder Urlaubshütten in den Sinn – nicht aber, dass es sich dabei um eine hochmoderne Bauweise handeln könnte. Dabei wäre es durchaus im Interesse des Klimaschutzes, vermehrt auf Holz als Baustoff zu setzen. Denn die Welt erlebt einen Bauboom, und die Betonproduktion sorgt für reichlich CO2-Emissionen. Holz hingegen ist nicht nur ein nachwachsender Rohstoff; Bäume fungieren außerdem als Kohlenstoffspeicher, da sie CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und einlagern.
In Deutschland werden jedoch bislang nur 18 Prozent der Gebäude aus Holz errichtet. Dabei könnte die Klimabilanz des Bausektors wesentlich besser ausfallen, wenn man den Anteil erhöhen würde, wie Prof. Dr. Annette Hafner mit ihrem Team vom Lehrstuhl für Ressourceneffizientes Bauen der RUB zeigte. In einer 2017 veröffentlichten Studie rechneten die Ingenieurinnen und Ingenieure vor, wie viel CO2 man einsparen könnte, wenn man 55 Prozent der Einfamilienhäuser und 15 Prozent aller Mehrfamilienhäuser zwischen 2016 und 2030 aus Holz erbauen würde. Das Ergebnis beläuft sich auf 23,9 Millionen Tonnen CO2.
Ein Tool für die Kommunen
Unter anderem aufgrund solcher Zahlen hält es Annette Hafner für sinnvoll, dass Holz als Baumaterial eine größere Bedeutung bekommt. „Aus Klimaschutzgründen würde es sich lohnen“, sagt sie. Allerdings sei es nicht damit getan, auf nationaler Ebene zu beschließen, mehr auf Holzbau zu setzen. „Die Kommunen müssen dieses Vorhaben auch umsetzen können“, so Hafner. Um sie dabei zu unterstützen, entwickelt ihr Team gemeinsam mit der Firma Disy Informationssysteme ein Tool, mit dem einzelne Kommunen abschätzen können, wie viel Treibhausgase sie einsparen würden, wenn sie den Anteil der Holzhäuser in ihrem Ort erhöhen würden.

Das Projekt „Holzbau-GIS: Einsparungen von Treibhausgasen durch Bauen und Sanieren mit Holz“ läuft noch bis Ende Januar 2022, gefördert durch das Bundesumweltministerium und das Bundeslandwirtschaftsministerium. Die Abkürzung GIS im Projekttitel steht für Geoinformationssystem, denn ein solches bildet die Basis für das Tool. Es liefert einen detaillierten digitalen Plan aller Bauwerke einer Kommune, die straßenweise auf ihr Klimaoptimierungspotenzial untersucht werden kann. Dabei wird nicht nur der Gebäudetyp mit einbezogen, zum Beispiel, ob es sich um ein Einfamilienhaus handelt, sondern auch das Alter der Häuser und somit ihr Sanierungsbedarf. Für die Entwicklung des Tools dient die Stadt Menden im Sauerland als Beispielkommune.
CO2-Einsparpotenziale berechnen
„Man kann einstellen, ob die Sanierung oder der Neubau bestimmter Stadtbereiche holzbasiert erfolgen soll oder nicht, und bekommt ausgerechnet, wie viel CO2 man dadurch einsparen würde“, erklärt Annette Hafner. Das Holzbau-GIS liefert aber auch Informationen darüber, welche Holzressourcen die Wälder der Umgebung zur Verfügung stellen würden. Das soll den Kommunen künftig ermöglichen, selbstständig abzuschätzen, ob Holzbau für sie realisierbar wäre und wie viel Treibhausgasemissionen sie dadurch einsparen würden.