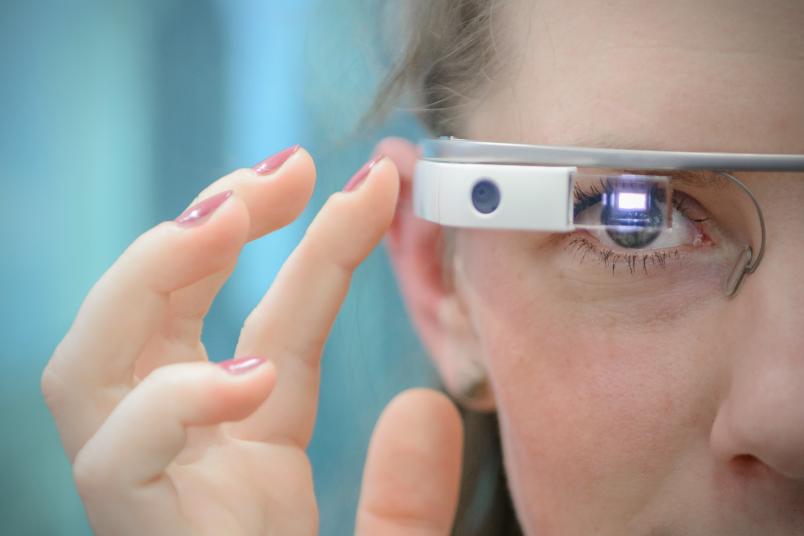Interview Digital Humanities: Was ist das und wo führt es hin?
Digitalisierung macht vor den Geisteswissenschaften nicht halt – davon kann die Forschung profitieren. Doch wer digital arbeiten soll, muss das Handwerkszeug dafür auch irgendwo lernen.
Der Digital Humanities Day findet am 14. und 15. Januar 2021 zum dritten Mal an der RUB statt. Ins Leben gerufen hat ihn Dr. Frederik Elwert, Digital-Humanities-Koordinator am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (Ceres). Im Interview wagt er einen Blick in die Zukunft und erläutert Chancen und Risiken der aktuellen Entwicklungen für die Geisteswissenschaften.
Ganz zu Beginn eine Grundsatzfrage: Was wird überhaupt unter Digital Humanities verstanden? Ist es ein neuer geisteswissenschaftlicher Forschungsansatz? Oder sind es unterschiedliche Methoden, die so bezeichnet werden, weil sie das Digitale in die geisteswissenschaftliche Forschung bringen?
Wie viele Grundsatzfragen ist genau das heftig umstritten. Ganz allgemein bezeichnet man mit Digital Humanities die Schnittmenge aus digitaler Technologie und Geisteswissenschaften. Ich sehe derzeit drei zentrale Bereiche: Erstens die Etablierung wirklich neuer Methoden in den Geisteswissenschaften, die etwa auf großen oder zumindest intelligent verknüpften Daten basieren. Das wird in letzter Zeit zunehmend unter dem Label Computational Humanities gefasst. Zweitens die digitale Transformation geisteswissenschaftlicher Methodik in der Breite, die eigentlich fast alle Fächer betrifft. Das kann man etwa im Falle digitaler Editionen beobachten, die mittlerweile in vielen Bereichen zum Standard gehören. Und drittens die Reflexion über gesellschaftliche Konsequenzen von Digitalisierung – auch wenn das im angelsächsischen Raum bislang stärker thematisiert wird als in den kontinentaleuropäischen Digital Humanities.

Für mich sind die Digital Humanities erst einmal eine Gelegenheit, sich über den Stellenwert des Digitalen in den Geisteswissenschaften auszutauschen.
Das heißt, nicht alle geisteswissenschaftliche Forschung, die mit Computern durchgeführt wird und sich dem Digitalen widmet, gehört zu den Digital Humanities?
Die Abgrenzungen sind tatsächlich in vollem Gange. Das Kriterium des Einsatzes digitaler Technologie ist natürlich wiederum sehr breit, und ganz ohne Computereinsatz sind die Geisteswissenschaften ja gar nicht mehr vorstellbar. Trotzdem gibt es viele Befürworterinnen und Befürworter eines „Big Tent“, das erst einmal allen einen Platz gibt, die sich selbst als Teil der Digital Humanities definieren. Mit den Computational Humanities sehen wir gerade einen exklusiveren Zugang, der einfach die Fortsetzung des alten mit neuen Mitteln nicht gelten lassen würde. Für mich sind die Digital Humanities erst einmal eine Gelegenheit, sich über den Stellenwert des Digitalen in den Geisteswissenschaften auszutauschen. Ich würde mich freuen, wenn am Ende dieses Prozesses ein stärkeres Bewusstsein in den Geisteswissenschaften stünde, welche methodologischen und epistemologischen Konsequenzen der digitale Wandel für unsere Forschungstraditionen hat.
In den empirischen Sozialwissenschaften ist die Anwendung digitaler Tools nichts Neues. Wo liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Digital Humanities?
Ja, das stimmt, und als jemand, der selbst auch Soziologie studiert hat, wundere ich mich manchmal über den begrenzten Austausch. Beide Bereiche könnten meines Erachtens viel voneinander lernen und zum Beispiel im Bereich der Netzwerkforschung gibt es auch durchaus einen gewissen Methodentransfer. Aber auch die Sozialwissenschaften mit ihrer in Teilen viel stärker quantitativen Forschungstradition sind ja vom Aufkommen von Big Data nicht unberührt geblieben, viele methodische Gewissheiten gelten auch hier nicht mehr uneingeschränkt. Das kann man etwa am Aufkommen der Computational Social Sciences sehen. Dort konnte man teilweise den Eindruck bekommen, dass Informatikerinnen und Informatiker, Physikerinnen und Physiker mit ihren Methoden den klassischen Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern den Rang ablaufen. Was mich an den Digital Humanities reizt, auch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, ist die Auflösung der Grenzen zwischen qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen. Die neuen Methoden machen eine strikte Trennung der beiden Zugänge viel weniger zwingend.
Mitte Januar 2021 gibt es den dritten Digital Humanities Day an der RUB. Wie kam es überhaupt dazu, vor zwei Jahren solch eine Veranstaltung ins Leben zu rufen?
Am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien waren wir seit einiger Zeit in den Digital Humanities aktiv. Während es über Konferenzen und Workshops viel Kontakt zu Projekten an anderen Universitäten gab, fehlte damals eine vergleichbare Plattform für digitale Geisteswissenschaften an der RUB. Ich hatte den Eindruck, dass sich einige durchaus mit digitalen Zugängen beschäftigten, aber eher getrennt voneinander und vielleicht auch noch nicht zwingend unter dem Label Digital Humanities. Der erste Digital Humanities Day, den ich 2018 mit meiner Kollegin Julia Heinig organisiert habe, sollte daher überhaupt erst einmal sichtbar machen, was es alles an der RUB gibt, und einen Ausgangspunkt für eine stärkere Vernetzung bieten. Das hat in meinen Augen auch wunderbar funktioniert.

Die Gründung des Digital Humanities Centers als Support-Einrichtung an der Universitätsbibliothek war sicherlich ein Meilenstein.
Welche Entwicklungen sind in den Digital Humanities über die vergangenen Jahre hinweg an der RUB zu sehen?
Die Digital Humanities sind an der RUB deutlich sichtbarer geworden und etablieren sich zunehmend. Das ist auch den Bemühungen im Rahmen der Exzellenzstrategie zu verdanken, die zumindest in dieser Hinsicht durchaus fruchtbar waren. Darüber ist der Kontakt mit Prof. Dr. Katja Schmidtpott aus der Japanologie zustande gekommen, die seit dem zweiten Digital Humanities Day als treibende Kraft mit dabei ist. Und es war sicherlich hilfreich, dass wir den zweiten Digital Humanities Day bewusst zu einer Plattform für die Diskussion über die Zukunft der Digital Humanities an der RUB gemacht haben und hierfür auch Prof. Dr. Andreas Ostendorf als Prorektor für Forschung gewinnen konnten.
Bochum ist sicherlich noch kein Digital-Humanities-Leuchtturm wie vielleicht Köln oder Darmstadt. Aber es tut sich unglaublich viel, was das Aufgreifen digitaler Methoden gerade in den kleineren Fächern und den Area Studies anbelangt, was man an Projekten in den verschieden Asienwissenschaften oder eben auch in der Religionswissenschaft sehen kann. Auch in der Linguistik und der Archäologie an der RUB spielen digitale Methoden eine große Rolle.
Und wie ist der Stand heute?
Die Gründung des Digital Humanities Centers als Support-Einrichtung an der Universitätsbibliothek war sicherlich ein Meilenstein für die Etablierung der Digital Humanities an der RUB und wäre zumindest so schnell ohne den Digital Humanities Day vermutlich nicht realisiert worden. Hier habe ich mich sehr gefreut, dass das Rektorat so viel Offenheit für das Thema gezeigt und auch konkrete Zusagen gemacht hat. Nach wie vor ist die Bandbreite der Digital Humanities sehr groß, nicht nur mit Blick auf die Fächer, sondern auch auf die Form: Zum Teil passiert wahnsinnig innovative Forschung auf der Ebene von Doktorarbeiten, ohne dass das Thema im jeweiligen Fach schon sehr etabliert wäre. Zum Teil sehen wir jetzt aber auch größere Vorhaben, die digitale Methoden als zentralen Baustein beinhalten, wie das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Langzeitprojekt „Zoroastrian Middle Persian: Digital Corpus and Dictionary“ meines Ceres-Kollegen Prof. Dr. Kianoosh Rezania. Wir hoffen, den Austausch auf Seiten der Forschenden auch über den Digital Humanities Day hinaus zu intensivieren und wollen den dritten Digital Humanities Day daher auch für die Gründung eines Digital-Humanities-Netzwerkes an der RUB nutzen.
Auch wenn ein Blick in die Kristallkugel digital alles andere als möglich ist: In welche Richtung werden sich die Digital Humanities an der RUB entwickeln? Oder anders gefragt: In welche Richtung sollten sie sich entwickeln?
Ich glaube, dass das Thema zukünftig noch eine größere Rolle in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses spielen wird. Wir sehen in der Forschung einen großen Bedarf an Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, die digitale Methodenkompetenzen mitbringen, aber irgendwo müssen sie diese ja auch erwerben. Mit dem Data-Literacy-Programm und dem Methodenzentrum gibt es hier schon Ansatzpunkte, an die die Fächer anknüpfen können. Aber natürlich ist es ein längerer Prozess, bis so etwas Eingang in die einzelnen Curricula gefunden hat. Auch für den Graduate-Bereich kann es sicher noch mehr Angebote geben, viele beschäftigen sich erst im Zuge ihrer Promotion intensiver mit digitalen Methoden.
Eine zweite Frage ist, ob auch die Forschung an der RUB von der Einrichtung dezidierter Digital-Humanities-Professuren profitieren würde. Da, wo die Fakultäten das als neuen Schwerpunkt begrüßen, wäre das mittelfristig sicherlich sinnvoll. Das wäre meines Erachtens auch eine konsequente Fortsetzung der sogenannten Wanka-Professuren, bei denen die RUB ja auch schon einen Schwerpunkt auf das breitere Thema digitale Transformation gelegt hatte.
Welche Forschungsgebiete könnten davon profitieren?
Davon, den Stellenwert und die Konsequenzen des digitalen Wandels auch im eigenen Fach zu reflektieren, können meiner Meinung nach alle geisteswissenschaftlichen Forschungsgebiete profitieren. Das heißt nicht, dass alle zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen müssen. Gerade für die kleinen Fächer bietet das Thema aber meines Erachtens das Potenzial, von neuen Entwicklungen zu profitieren, ohne die eigene Kernkompetenz aufzugeben. Im Gegenteil, gerade im Kontext großer Initiativen wie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur halte ich die Stimme der kleinen Fächer und damit auch den Blick auf die besonderen Anforderungen bei der Erforschung außereuropäischer Kulturen für ganz maßgeblich.

Ich sehe überwiegend einen sehr reflektierten Umgang mit den neuen Methoden.
Neben all den Möglichkeiten sollte der Blick auf die Grenzen nicht fehlen: Welche Beschränkungen haben die Digital Humanities? Welche Risiken gibt es hinsichtlich der Forschung? Und ist geisteswissenschaftliche Forschung an der Universität im 21. Jahrhundert auch außerhalb der Digital Humanities noch möglich?
Die Digital Humanities können da problematisch sein, wo unhinterfragt bestimmte Paradigmen anderer Wissenschaftsbereiche übernommen werden. Es gab durchaus berechtigte Kritik daran, dass mit den Digital Humanities teilweise neo-positivistische oder neo-liberale Konzepte eingekauft wurden. Ich sehe aber überwiegend einen sehr reflektierten Umgang mit den neuen Methoden und ihrer Passung zu den eigenen wissenschaftlichen Grundannahmen.
Die Frage, ob zukünftig alle Humanities auch Digital Humanities sein werden, ist ein beliebtes Orakelspiel im Feld. Ich glaube, dass sich beide Entwicklungen nicht ausschließen: Manche Technologien werden sicherlich in der Breite Einzug in die Praxis der Geisteswissenschaften finden, so wie heute auch niemand mehr Manuskripte auf der Schreibmaschine verfasst. Und dann sollten wir das auch reflektiert und auf Grundlage einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung tun. Andere Methoden, gerade die stark quantifizierenden, werden vermutlich eher – im besten Sinne – eine Nische bleiben. Und vielleicht entsteht dafür gerade tatsächlich mit den Computational Humanities eine eigene, geisteswissenschaftliche Disziplin.